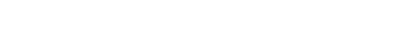Beitrag zum Katalog der Ausstellung ›Ernst Wilhelm Nay‹
Galerie im Erker, St. Gallen, 25. November 1967 – 31. Januar 1968
Meine Farbe
Die Farbe als künstlerischer, geistig zu formender Wert ist so inkommensurabel, so unberechenbar, daß jeder Maler, der eindeutig von der Farbe her gestaltet, sich gezwungen sieht, die Farbe für sich selbst neu in ein System einzuordnen und mit Hilfe dieses Systems zu formulieren. Ein System entwickeln, das nicht nur für den Erfinder gültig ist, sondern objektiv zu bestehen vermag und zugleich zeitgenössisch bedeutungsvoll ist, indem es mit anderen Strömungen der Zeit korrespondiert, so heißt die Gesamtaufgabe eines Malers, der naturgemäß aus seinem Wesen heraus sein Leben mit einem solchen System erfüllt sieht. Daß diese Aufgabe ohne intellektuelle Willensbetätigung im Ansatz in ihm vorhanden ist, er alle seine Kräfte, sehr auch die intellektuellen Kräfte, an diese Aufgabe setzt, das entspricht eindeutig dem Koloristen. Ein Kolorist ist ein Maler, der durch die Farbe denkt und die Anschauung durch die Farbe vollzieht. Ob der Farbträger oder die Farbe der Ausgangspunkt ist, erhellt sich zugunsten der Farbe, besonders wo die Probleme des Realismus – Gegenstand, Licht und Schatten – fortfallen und die Zeichnung fast nur als Umrandung einer Farbfläche auftritt. Es ist ein Leben wert, so weit vorzudringen, daß das reale Farbbild entstehen kann, und die Farbe dabei so klingt, daß ohne besondere Absicht des Künstlers Menschliches anschaubar wird, Menschliches und Kreatürliches in neuer, unbekannter Formulierung. In diesem Vorgang sehe ich die Idee der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, soweit es sich um Malerei handelt. Die erste Hälfte hatte die Liberation des Bildes gebracht und die Identität von Bild und individueller Freiheit und Unabhängigkeit und die grundsätzlichen Formtendenzen der Malerei neu und eindeutig zutage gefördert.
Die optischen Farbenlehren ließ ich ebenso beiseite wie die daraus entwickelte Lehre der Komplementärfarben; ich erfand mir dagegen ein punktuelles System, das Scheibensystem. Dieses System ist nicht wie bei Delaunay von den physikalischen und komplementären Bedingungen der Farbe getragen, sondern von der artistischen, der unabhängigen, von allem Zugänglichen der Naturwissenschaft und der Natur unabhängigen ›Satztechnik‹ der Farbe. Dies war das erste System in meiner Kunst, dem später ein zweites folgte. Das System der farbigen Satztechnik, das punktuelle Scheibensystem, ermöglichte die geradezu choreographische Begehung der Fläche. Scheiben, mehrere Scheiben gleicher Farbe, überliefen die Fläche und bildeten, jede Farbgruppe der Scheiben, eine ungegenständliche Figuration. Zusammen bildeten die Scheibengruppen – zum Beispiel in drei verschiedenen Farben – eine Konstellation auf der Fläche. Die Zwischenräume zwischen den Scheiben bildeten wiederum in mehreren Farben, die jede für sich die Fläche durchwanderten, ungeformte, Zwischenform bildende Sätze. Dabei mußte vor allem jede Farbe, ob die der Scheiben oder die der Zwischenräume, flach der Fläche angehören, wiewohl etwas an Fläche entstand, was ich mit 22 Jahren »ich wollte wie Wellblech malen« nannte. Diese Wellenbewegung erzeugte einen flachen illusionistischen Raumvorgang verschiedener Intervalle. Das Problem des Flachraums war auf diese Weise einmal eindeutig durchdacht, doch sollte das zweite System die umfassendere Lösung bringen.Mit Perspektive und Illusion hatte ich prinzipiell nichts zu tun. Der Raum, den der heutige Mensch Raum zu nennen versucht, ist unanschaubar geworden wie das Ding, das in seiner allgemeinen Sichtbarkeit nur noch der Plakatwelt zu dienen vermag. Bei jenem ersten, punktuellen System ergab sich nun außerdem, als ich die Bilder durchdachte, daß bei der Auszählung der Scheibengruppen und der Negativgruppen ein ungleiches Zahlenverhältnis entstand, das dann weiterhin das System vervollkommnen konnte. Drei, drei, drei, vier zum Beispiel. Damit ließen sich dann farbige Harmonien und Disharmonien in einer geordneten ›Satztechnik‹ aufzeichnen, zugleich Hell und Dunkel beachtend. Zuweilen setzte ich eine ganz und gar zum gewählten Farbkreis eines Bildes nicht zugehörige Farbe einzeln ein, die die anderen Farben kontrapunktierte. Dieses Scheibensystem, diese ›Satztechnik der Farbe‹, war akausal, denn es wurde bewußt kein Wert darauf gelegt, welche Farbe neben welche kam. So hatte ich schon als junger Mensch mit den Farben operiert. Und das machte die Bilder exzentrisch und scharf bei oft sehr hellen und sozusagen fröhlichen Farben. Die Kombination exzentrisch und mild scheint meiner Natur zu entsprechen.
Der Kolorist hat von vornherein eine beschränkte Palette, die er sogar im weiteren Verlauf des Lebens noch stärker beschränken wird. Die Farbe hat ja doch in meinen Systemen keinen gewollten seelischen Ausdruck, sondern wird ›gesetzt‹ gemäß der Satztechnik. Die Skala wandelt sich, ohne daß eine eigentliche Absicht vorliegt, doch bevorzuge ich kühle Farben, auch die wärmeren Farben kühl zu setzen. Die unendliche Möglichkeit zur Kombination läßt mich mit etwa 14 Farben auskommen, von denen für ein Bild höchstens drei bis acht angesetzt werden. Das Weiß der Farbe beizumischen, habe ich mein Leben lang streng kontrolliert, neuerdings fast immer ganz vermieden, den Auftrag der Farbe aber derart vorgenommen, daß die Farbe – an sich absolut gesehen – klang. Und nun zum zweiten System. Ich fand bei längerer Anwendung der ›Wellblechfläche‹, daß ich zur reinen Fläche vorzugehen hatte, und beendete die Scheibenperiode, von der nur hin und wieder Elemente späterhin mitverwendet wurden. Die positiven und negativen Werte mußten sich nun nicht mehr wie bisher durch Vexierung angleichen, sondern der Gegensatz ›positiv-negativ‹ mußte durch direktes reales Setzen der Farbe aufgehoben werden. Wie bisher und immer komponierte ich vorerst einen Farbklang von mehreren Farben und zugleich mit diesem Farbklang als Farbträger eine Reihung von meist senkrechten, eine eigene unabhängige Form bildenden Formen, die entweder aufeinander bezogen oder akausal gesetzt wurden. Sehr einfach setzte ich nun die komponierte Farbreihe von einer Seite des Bildes ausgehend ein und ließ sie sich in gleicher Reihenfolge wiederholen. Doch die Reihenfolge ist ein Geheimnis. Mit dieser Flächensetzung der Reihung lösten sich die Gegensätze von positiven und negativen Formen auf, und zugleich standen die Farben real auf der Fläche, die Fläche realisierend. Die Farbreihe war prinzipiell zufällig erfunden – wiederum ohne Bezug auf physikalische Gesetze. Diese nunmehr eindeutige Zweidimensionalität des Bildes, in dem die Flächenfarbe real gesetzt war, emanierte von selbst, einmal durch das bei aller Festigkeit der Farbe auftretende Licht der Farbe und zum anderen durch die Abfolge der Farbflächen, überraschend Kreatürliches. Dieses erscheint aber nicht in realer Form.