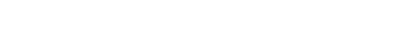Antwortbrief an ›Der Tagesspiegel‹, Feuilletonredaktion, Heinz Ohff
›Der Tagesspiegel‹, Feuilletonredaktion, Heinz Ohff, an Nay. Berlin, 28. 11.1962
1. Welchen Zugang haben Sie zu den zeitgenössischen Bestrebungen der neueren Musik?
2. Haben Sie ein Verhältnis zur neuesten Literatur, sei es das absurde Theater, etwa Ionesco, oder dem nouveau roman?
3. Berührt Sie die moderne Architektur in irgendeiner Weise und glauben Sie an gleichzeitige Bestrebungen in Ihrer Malerei?
Daß sich Architekten für Musik und Malerei interessieren, Maler für Musik und Architektur, das ist heute fast selbstverständlich. Schwieriger ist es mit der Literatur und dem Theater. Die letzten fünfzig Jahre haben für alle Künste fast die gleichen oder zumindest sehr ähnliche Umwälzungen gebracht. Und tatsächlich sind sich die Künste in den letzten Jahrzehnten mehr als einmal direkt begegnet.
Wenn auch nicht konsequent, so habe ich mich mit den anderen Künsten, der Musik, der Architektur und der Literatur unserer Tage immer wieder beschäftigt. Schon vor den Zwölfton-Musikern Schönberg und Webern war es sehr viel früher Bartók, dessen System der wechselnden Rhythmen mich in einer Phase meiner Kunst stark angezogen hatte. Die großartigen Ton- und Sprachwerke Schönbergs – u. a. Moses und Aaron und Die Jakobsleiter – und die konstruktiven Werke Weberns haben mich oft und oft fasziniert. Besonders an der absoluten Tonsetzung und den oft ausgedehnten Negativformen der Musik Weberns fand ich ein direktes Interesse. Das war um 1950 herum. Später kamen die Kompositionen der seriellen und punktuellen Musik hinzu. Neben Dallapiccola und Nono beeindruckt mich Boulez am meisten. Dieser wegen seiner ausgiebigen Arbeit in der elektronischen Musik, deren Technik ich hier in Köln kennenlernte. Ich meine, daß Boulez der einzige elektronische Musiker ist, der dem elektronischen Klang die sinngemäße Musik erfindet.
Die moderne Architektur hat mich erst in den letzten Jahren angezogen. Und da besonders die letzten Werke der neuesten Zeit, die Bauten von Aalto, Saarinen – Flugplatz-Empfangsgebäude von ldlewild –, dann die Großmarkthalle in Hamburg von Hermkes und, wie ich annehme, obwohl noch nicht gesehen, außer in einer Photographie, die Philharmonie in Berlin von Scharoun. Es ist da in der Architektur eine ähnliche Wandlung in der letzten Zeit geschehen wie in der Malerei. Das Bauhaus, Gropius und Mies van der Rohe, hatten ja die echten Funktionen des Bauens, das werkgerechte Bauen in der Nachfolge von van de Velde wiedergefunden. Daraus entwickelten dann die neueren Architekten jene glanzvolle, organisch-poetische Architektur unserer Tage. Daß sich in dieser Architektur Phantasie und Funktion so bruchlos verbinden, darin sehe ich die gleiche Grundlage, die auch meine Malerei trägt. Und ich bin der Meinung, daß hierin die schöpferische Kraft unserer Gegenwart liegt.
Zum Theater habe ich keine besondere Beziehung. Brecht wie Dürrenmatt scheinen mir recht zu haben, wenn sie sagen, daß mit dem Theater der Mensch in seinen Grundproblemen heute nicht mehr erreichbar sei, selbst dann nicht, wenn man sich bemüht, gegen das Theater Theater zu machen.
Was die Literatur anbelangt, so habe ich sogar Musils Mann ohne Eigenschaften bis zur letzten Seite durchgelesen, ebenfalls die beiden Bände des Ulysses von Joyce und in ganz frühen Jahren, wie auch später, Kafka. Ich würde also eine Linie des modernen Romans sehen, die von Proust über Kafka, Musil, Joyce zu Beckett und Genet führt. Eine zweite Linie wäre für mich Henry Miller, Hemingway und Salinger.[1] Und doch möchte ich für mich persönlich glauben, daß der Roman als Kunstform zu Ende geht und die Dichter einmal der Gleichung: Wort gleich Wort gegenüberstehen. Übrigens hat Hans Arp in seinen dadaistischen Gedichten von vor nunmehr 30 Jahren einen wunderbaren Ansatz dazu gegeben.
Zum Schluß macht mir doch die Bemerkung Vergnügen, daß es in der Welt nicht nur die Eingeweihten und Fachleute sind, die sich mit diesen Dingen beschäftigen, sondern auch – und auch dies ist ein deutliches Zeichen unserer Gegenwart – der Mensch, den man Bürger nennt, lebhaftesten Anteil an den verschiedenen modernen Künsten in unserer Zeit nimmt.
[1] Jerome David Salinger (geb. 1919), amerikanischer Schriftsteller, behandelt in seinen Romanen und Erzählungen besonders die aufständische Haltung der Jugendlichen und deren Probleme, Hauptwert: ›Der Fänger im Roggen‹.