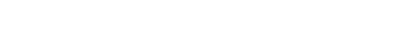Antworten zu vier Fragen des Carnegie-Instituts
Der folgende Fragebogen des Carnegie-Instituts, Pittsburgh, USA, wurde Nay im Vorfeld der Ausstellung ›The 1967 Pittsburgh International Exhibition of Contemporary Painting und Sculpture‹ (The Carnegie Institute, Pittsburgh, 27. Oktober 1967 – 7. Januar 1968) zugesandt. Diese Ausstellung fand jährlich aus Anlaß der Verleihung des Carnegie-Preises statt. Im Jahr 1967 beteiligte sich Nay mit dem Bild ›Mit roter Spindel‹ von 1966 (WV 1213). Aus diesem Grund bat man ihn zur Mitarbeit an einer Studie, die die Beziehung zwischen Kunst und Wissenschaft betraf:
A) In welcher Weise sind Sie von der gegenwärtigen Wissenschaft oder Technologie beeinflußt (z.B. durch Verwendung von Acrylic-Farben)?
B) Wenn Sie Künstler unterrichten, entweder in Schulen oder in Vorbereitungskursen, würden Sie die Schüler ermutigen, Mathematik oder Naturwissenschaften zu studieren? Wenn ja, warum und in welchem Maße? Wenn nicht, warum nicht?
C) Welche Themen würden Sie einem angehenden Künstler raten zu studieren – durch Texte oder durch Experimente?
D) Würden Sie versuchen, im einzelnen den schöpferischen Prozess zu beschreiben, z.B. wie beginnen Sie ein Kunstwerk? Vielleicht ist es Ihnen möglich den Werdegang des für die diesjährige Carnegie-Ausstellung eingesandten Bildes zu schildern.
A) Im Zeitalter der gebauten Wissenschaft, in dem die Technik zweitrangig geworden ist, steht der Mensch der Gegenwart zum ersten Male in der Geschichte der Menschheit sich selbst gegenüber. So Heisenberg. Mit den Mitteln der Technik ist für die Kunst nichts zu erreichen. Die Versuche dieser Art gehören in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Das Handwerkszeug des Malers ist der Denkprozeß und das intellektuelle System. Mit beidem geht er an die Fläche heran. Perspektive und Illusionsraum existieren nicht mehr. Logik und Kausalität sind durchbrochen. Alle bisherigen Ideenformen sind unbrauchbar geworden. Der Maler erfindet sich ein System, die Fläche zu begehen, und findet am Ende ein bisher unbekanntes Darstellungsbild der Physis des Menschen. Das Bild also erreicht auf diese Weise die Vision.
B) Unterricht ist unter diesen Voraussetzungen zweifelhaft, Kunstschulen unnötig. Das Handwerkszeug der einfachen Maltechniken ist in Handwerksschulen erlernbar. Dagegen sollte sich der Student nach der modernen, nicht-euklidischen Mathematik, Topologie etc. umsehen und dazu nach der Elektronik.
C) Alles in A und B gesagt.
D) Das Carnegiebild 1967 (›Mit roter Spindel‹)
Die drei Grundfarben Rot, Gelb, Blau in senkrechten Reihenformulierungen gesetzt, die verschieden sind – Vollformen gegen durchbrochene Formen. Die Farbe von links nach rechts oder von rechts nach links behält die einmal angesetzte Reihenfolge bei. Dadurch wird die echte Fläche erreicht und das ist sicher einer der wesentlichsten Punkte. Alle Formen, auch die Weißformen sind nun positiv, die Fläche ist fest und doch nicht Plakat. Dies ist das bewußt entwickelte und bewußt angewandte System – gemäß der Bewußtheit des modernen Menschen.
Formen und Farben emanieren dabei Primitives, Primäres, Einfaches, d.h. aus dem Bildprozeß, der denkend vollzogen wurde, entsteht die Vision eines kreatürlichen Aspekts, der emotionell erfahren wird. Das zielt auf eine neue Gefühlstechnik ab, denn dies Bild ist figürlich in einer bisher unbekannten Art. Damit ist Wirklichkeit erreicht.
In einer früheren Fassung äußert sich Nay zu Frage B ausführlicher:
B) Ich lehne Unterricht ab, außer er wird von Fachlehrern betrieben, nicht von Künstlern. Künstler sind Individuen und zerstören sich im Unterricht. Fachlehrer aber sollen die Studenten besonders in die moderne Physik, die moderne Mathematik und in die Psychologie einführen. Diese drei Fächer halte ich für unerläßlich. Diese Einführungen sollen nur ein prinzipielles Bekanntmachen sein, kein auf fachliches Können Hinarbeiten. Die moderne Physik, um die Auflösung von Perspektive, den drei Dimensionen und Logik kennenzulernen, und die Auswertung des Bewußtseins. Dazu moderne Mathematik, also nicht Euklid und Geometrie. Und die Psychologie, nicht im Sinne der Massenbehandlung, der Kenntnisnahme der Massenmedien, sondern zur Kenntnis der Bewußtseinssphäre, die dem Menschen möglich ist. Der Student ist derart zu belehren, daß er merkt, daß all dies nicht zur Kunst führt, nichts mit Kunst zu tun hat, aber dem Künstler die Möglichkeit gibt, die Grenze der Bewußtheit immer weiter hinauszuschieben und damit zugleich die formale Betätigung, soweit, bis unbewußtes Neuland von selbst sichtbar wird.