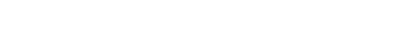Vorbereitende Niederschrift zum Film ›Kunst authentisch‹
1) Ein Künstler, der von seinem Werk sprechen soll, wird natürlich am liebsten von der Situation anfangen, in der er zum ersten Mal sein Werk und sein Leben identisch sieht, d.h. also die erste Setzung seiner eigenen Kunst in ernster Selbstkontrolle feststellen kann. Ich würde, und das hat sich nun in der Öffentlichkeit auch bereits festgelegt, die ›Lofoten-‹ und die vorhergehenden ›Fischerbilder‹ nennen. In diesen Bildern ist zum ersten Mal das zu sehen, was in meiner Kunst später in der weiteren Entwicklung den Hauptakzent ergeben wird. Das sind Bilder, die das Dynamische und das Rhythmische betonen im Bildnerischen und die noch mit der Natur umgehen, aber mit der Natur nicht im Sinne der optisch sichtbaren Natur, die jeder Mensch sieht, sondern mit einer, ich möchte sagen, natürlichen Natur, in der das kreatürliche der Natur wichtiger zum Ausdruck zu bringen ist, als die äußere Erscheinung. Die äußere Erscheinung verbindet sich also, oder formt sich im Sinne dieser kreatürlich-natürlichen Natur. Man sieht bei den Fischerbildern Menschen, Meer und Wasser, Luft. Das Wasser und das Meer ist [sind] in seinen Funktionen gezeigt, im Aufsteigen und Ab der Wellen, und die Menschen sind in diese Natur eingesetzt auf den roten Faden einer gewissen Symbolhaftigkeit der Farbe, so daß also ein mehr kreatürlich wichtiges Ereignis aus dem Bild herausstrahlt, als ein optisches Geschehen eines Bootes auf dem Meere. Bei den Lofoten-Bildern handelt es sich im wesentlichen um Landschaften, die sind 1937/38 gemalt und auch kommen andere Bilder vor mit Figuren. Auch dort ist es die große Rhythmik der Berglandschaften der Lofoten, in die ich gegangen bin im Jahre 1937.
2) Der ehemalige Direktor des Folkwang-Museums, Dr. Ernst Gosebruch, der nun vor einigen Jahren verstorben ist, hatte auch sein Amt verlieren müssen und wohnte in Berlin und vermittelte mir einige große Sammler, die sich sehr für meine Kunst interessierten und die mir die sehr, sehr schwierige wirtschaftliche Lage in sehr großzügiger Art erleichterten. Ich kann dazu anbringen, daß eine Dame einmal in jener Zeit sagte, »es ist wunderbar, Herr Nay, wie Sie Kompositionen sehen und aus der Opposition malen«, und ich sagte: »Gnä’ Frau, das ist besonders schwer, ein Künstler kann an sich nicht aus einer Opposition malen, besonders nicht zu dieser Sache.« Das war etwas ganz ungewöhnlich Schwieriges, sich auch noch in seiner Kunst zu isolieren bis zum Letzten.
3) Diese ›Hekate-Bilder‹ werden genannt nach einem einzelnen Bild, das den Namen ›Hekate‹ hatte und sind eine Periode, die in den Jahren 1944 etwa bis 1949 gemalt waren, und sie beschäftigen sich nur allein noch mit der menschlichen Figur, allerdings auch gar nicht in einem optischen Sinne, sondern in einem mythischen Sinne. Daher gibt es auch solche Titel wie ›Olivia‹, das kam allerdings mehr aus dem Olivgrün, oder ›Hekate‹ oder ähnliche. Diese Bilder zerlegen sozusagen den menschlichen Körper in Formen, die zwar eine gewisse organische Verbindung eines Körpers zueinander noch ahnen ließen, aber bereits als eigenwertige Bildelementformen existieren. Die Bilder sind meist sehr prächtig in der Farbe und dick gemalt, und diese Periode ist dann 1949 etwa zu Ende gegangen.
4) Die Bilder der ›Hekateperiode‹, wie ich eben sagte, hatten also langsam das Gegenstandsbild der Figur aufgelöst. Es gab eigentlich nur ein Formen und [einen] Zusammenhang der gesamten Fläche und es war von daher kein sehr, sehr weiter Sprung natürlich zu einer Malerei, die sich ohne den Gegenstand bewegen konnte.
5) und 4a) Als ich aus der ›Hekateperiode‹ herauskam, waren die ersten Bilder von dem starken, expressiven Element der ›Hekate-Bilder‹ selbst noch getragen und auch von dem Kreatürlich-starken und Erdhaften dieser Bilder und äußerten sich in einer sehr vehementen Gestik im Jahre 1952. Und diese Gestik, die hatte aber zugleich eine gewisse Verbindung zu einer Bildordnung farbiger und formaler Gestalt. Es gab linearmäßig große Farbflächen, es gab rhythmische Kreise und Scheiben und aus diesen Elementen wurde ein solches Bild entwickelt.
6) Nun, als diese gegenstandslosen Bilder der Gestik, Farbgestik, verklungen waren, die aus rhythmischen, aus farbigen und zeichnerischen Elementen zusammengesetzt waren, machte ich eines Tages den sehr simplen, grundlegenden Gedanken mir klar, daß man, wenn man einen Pinsel in die Hand nimmt und diesen Pinsel in die Farbe tupft und mit diesem Pinsel auf die Leinwand geht, auf dieser einen Kreis, eine Scheibe, auf dieser etwas Anhaltendes, was die Fläche selbst ja auch an sich hat, darstellt. Und aus diesem Element, und das ist sehr interessant, wie sich das weiter entwickeln wird, entwickelt sich dann eine ganze Malerei. Denn dieser Vorgang, der jedem verständlich [ist] und eigentlich nur, weil er so einfach ist, gar nicht auffällt, zeigt, daß ich die ganze Malerei für mich selbst, die Farbgestaltung einer Fläche von mir aus selbst plötzlich abrufe, wie man so sagt, vom Ei her, vom letzten Anfang her wieder aufzustellen versuche. Und hier komme ich vor die letzte Frage meiner künstlerischen Entwicklung: Die entscheidende Frage, die sich jeder Künstler immer wieder stellen muß, hatte hier eine neue Formulierung gefunden und ich erfand dann ein System der Scheiben, der Farbscheiben, mit denen ich eine Bildfläche, sehr vorsichtig in diesen Jahren damals, bearbeitete mit dem Gedanken, eine Malerei als solche ganz als Malerei und ganz als eine Farbgestaltung der Fläche zugleich aufzubauen.
7) Das ist mit diesen Scheibenbildern dann so weitergegangen, daß ich interessanterweise feststellte, daß eine Scheibe ja auch ein Kreis ist und daß ein Kreis nicht nur ein gemalter Kreis, sondern der gemalte Kreis selbst ein Kreis wiederum ist. Auch diese Feststellung ist so primitiv wie die erste von der Pinsel-Feststellung, aber sie bedeutet sehr viel, denn auf diese Weise ist ein direktes Äußerungsvermögen des Künstlers gegeben, direkt ein Bild aus seiner Instinkthaftigkeit heraus zu malen und eine Störung in dieser Beziehung zur Fläche, ein Gegenüber der Fläche weiterhin noch mehr aufzulösen.