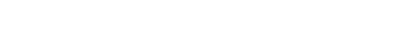Äußerungen in dem Fernsehfilm ›Kunst authentisch: E. W. Nay‹
Nordwestdeutscher Rundfunk, Köln 1963
Drehbuch: Horst Richter, Regie: Peter Gradion
Zu seinem Namen:
Der Name Nay ist gewöhnlich elsässisch bekannt mit ey, und so hat man mich immer falsch geschrieben, und daraufhin machte ich dann das A groß, damit man’s merkt.
Über die Entstehung von Bildern:
Die Kunst des Malens ist eine stumme Kunst und ein magisches Tun. Im Bilde verschlüsselt liegt die Aussage, die sich auch ohne Bildtitel mitteilt. Über die Entwicklung aber, die jeweils zu einer solchen Zusammenschau führt, läßt sich sprechen. Der Mensch, der die Anlage zur Kunst hat, entwickelt sich ja folgerichtig und organisch.
Der Gegensatz ›Natur und Ich‹ wird die erste Phase bestimmen. In frühester Jugend bewunderte ich zwei Künstler, die, ohne daß ich das damals wußte, die beiden Grundformen meiner Natur für mich darstellten. Der Große französische Meister der Farbe Henri Matisse und der deutsche magische Romantiker C. D. Friedrich. Der eine für die farbige, koloristische Seite meiner künstlerischen Anlage, der andere für die magische.
In eine Zeit hinein geht diese Entwicklung, in der der gleißende Atomblitz einerseits auf eine neue Erfahrung des Universums weist, andererseits auf Unheil und Gefahr. Wir stehen im Dunkel oder im blendenden Licht. Ich habe mir immer vorgestellt, daß ich nicht unter das Bewußtsein gehen müsse, ins sogenannte Unbewußte des Dunklen, Unbekannten, sondern in das Überbewußtsein einer umfassenden, nicht materialistischen Wirklichkeit.
Und keinesfalls in die Dämmerung eines ungefähren Träumens. Man wird sehen, wie sich der Gegensatz farbig bildnerische Gestaltung zum magischen Gehalt immer wieder ausspielt und schließlich ein Zusammenspiel entsteht, eine Analogie, eine Übereinstimmung im Universum, das ja die Welt, den Kosmos, die Natur und den Menschen umfaßt – dies in der Kunst als Erlebnis. Autodidaktisch, also vor einem Kunstunterricht, entstanden einige Porträts, die ich als 22-jähriger malte. Ich malte diese Bilder nicht anders als ein Sonntagsmaler. Aber diese Bilder zeigten bereits ganz deutlich die Fähigkeit, eine Fläche aus der Farbe heraus zu formen. Eine Farbkomposition war da entstanden. Und eine Kugel, die später Bedeutung annehmen wird. Nach diesen Bildern kam eine Schulung in Berlin bei Karl Hofer, der im Grunde sehr andere Vorstellungen hatte. Aber er war aufgeschlossen und modern. Nach Abschluß dieser Schulung entstand eine Pause, eine Pause, die schließlich in die magische Seite meiner Anlagen ausschlug, etwa einen Apfel zu malen, nicht wie ihn jeder sieht, sondern wie er mir als Kosmos sich präsentieren könnte. Die andere Seite also, die magische. Diese andere Seite ging über mehrere Jahre, teils in voller Abstraktion – um 1930 – in der sich Ähnlichkeiten mit der Musik einstellten, teils in surrealistisch-mikroskopischen Darstellungen. Dann meldete sich wieder die Fläche als Ganzes, die Farbe, die große Form. Vom Mikrokosmos zum Tier, zum Menschen, zur Landschaft in dynamisch-rhythmischen Farb- und Formsetzungen.
Hekate-Bilder – nächste strengste Kontrolle im mythischen Bilde – konstruktiv – es wechselt also auch die konstruktive mit der expressiven Seite. Wieder die expressive in den Bildern von 1952-53, bis 1954 der entscheidende Punkt des Lebens erreicht wird mit der Erfindung der Scheibe als artistisches bildnerisches Farbelement und, wie man später sehen wird, auch zugleich als magisch-mythisches Element.
Die Entstehung eines Bildes zu erzählen, das ist vollkommen unsinnig, das wird man nie erwarten können und nie fordern dürfen. Das Atelier ist eine Klause, und dort grübelt man herum, man malt nicht immer. Man malt, wenn man merkt, daß man im Herumgehen plötzlich auf das Trampolin springt, und dann springt man ab und springt in ein Bild, von dem man nicht weiß, wie es zu Ende geht.
Es ist ganz sicher, daß ein Künstler zuweilen überhaupt nichts machen kann, restlos unfähig ist, sich überhaupt zu erinnern, daß er was kann oder machen könnte. Bei mir ist es z.B. so, die Wut zu erzeugen, und dann plötzlich springt man wieder auf das Trampolin.
Jeder Künstler hat das, daß er malen möchte, und es fällt ihm nichts ein, es geht nicht. Es taucht vielleicht irgendwo ein Farbklang auf, so weit würde ich wohl gehen, ja, es ist eben doch anders als bei Malern, die mit irgend einem Punkt im Realistischen sitzen. Sie gucken einen Apfelbaum an und können ein Bild malen. Ich brauche nur den Anlaß, malen zu können, und das weiß ich nie. Ich will ja nicht mal sagen, daß einem überhaupt was einfällt, wenn man malen will, sondern man kann plötzlich malen. Denn ich male ja ins Blaue. Das Abenteuer der weißen Leinwand ist für mich ein selbstverständlicher Begriff. Ich habe sehr wenig Mittel in der Hand, um dort etwas vorzufinden. Das andere muß im Entstehen sich zeigen. Ich rufe da Geister auf, die noch nicht vorhanden sind –, wenn’s gut geht.
Über die sogenannten ›Fischer- und Lofoten-Bilder‹ der Jahre 1936-38 und die Zeit der Verfemung moderner Kunst:
Ich wurde durch Freunde eingeladen, nach Norwegen zu gehen und Edward Munch zu besuchen, der mir dort die Möglichkeit gab, einige Monate zu bleiben. Dort nun entwickelte sich eine neue, weitere Verfeinerung dieses dynamisch-rhythmischen Prinzips im Sinne dieser großen Landschaften, der großen Fermaten, dieser Bergzüge, in denen auch Fjorde waren und Fischerboote und Menschen. Und ich kam dann auf die weitere Idee, aus den Wellen des Meeres und den Menschen, die mit den Fischerbooten hinausfahren auf das Meer, aus diesen Elementen Bilder zu malen. Hier arbeitete ich in einer sehr langsamen Weise Bild für Bild in einzelnen, kleinen Zeichnungen vorbereitend durch, bis dann endlich in einem Tage ein solches Bild gemalt wurde – erste dynamisch-rhythmische Setzungen, von denen noch Natur und Boote und Menschen in hieroglyphischer Form bildnerisch gestaltet wurden.
In dieser Zeit, als ich damals nach Norwegen ging, war meine Existenz restlos zu Ende. Ich lebte in einem kleinen Atelierraum unterm Dach. Ich hatte kaum Freunde. Den Freunden, die ich früher hatte, ging es genauso. Sie waren aus ihren Ämtern hinausgeworfen worden, und sie waren größtenteils auch im Ausland. Dann kamen weitere Einschränkungen hinzu: Ausstellungsverbot selbstverständlich und Materialkaufverbot. Die Verminderung war restlos, die Vereinsamung auch. Der Umgang mit anderen Künstlern stockte. Jeder hatte sich verkrochen. Man saß allein, es klingelte nie, kein Mensch kam, und der Kontakt fehlte zu einer Zeit, wo man noch nicht im geringsten fertig war, wo man eben anfing, sich auf eine persönliche Stufe zu setzen.
Konflikte isolieren einen an sich schon. Wenn nun das Politische hinzukommt, ist es eine höchste Verschärfung. Es ist eine fürchterliche Geschichte, sich konfrontiert zu sehen mit politischer Feindseligkeit, weil ein Künstler die im Grunde ganz ablehnt und nie begreift.
Über die im Kriege und danach entstandenen sogenannten ›Hekate-Bilder‹:
Im Kriege tauchte eine neue Vision der Bilder auf, eine große Reihe von Bildern, nicht sehr großen Formats, dick gemalt, mythischen Inhalts, die sogenannten Hekate-Bilder. Diese Bilder stellten wieder menschliche Figuren, einzelne menschliche Figuren dar und hatten ganz andere, bisher neue Farbprinzipien, die etwa mit den byzantinischen Ikonen eine gewisse Ähnlichkeit haben könnten, wenn man vorsichtig vergleicht. Es wurde dort erstmals ein Prinzip angewandt der flächigen Verdrehung von Figuren, so daß jede Form einer Figur zugleich direkte Fläche war, also nicht perspektivisch dargestellt wurde. Ein Augenmotiv vergrößerte sich, die Zwischenformen zwischen den Körperformen wurden durch Rautenmuster mit Punkten gesagt und dann kamen da Bilder heraus, die einen stark chthonischen, demeterähnlichen Zug aufwiesen.
Im Grunde ist es ganz deutlich, daß es 12 Jahre waren, von denen man nicht weiß, wären sie anders abgelaufen, wären sie schneller, langsamer abgelaufen. Ein Künstler fragt auch nicht danach, sind es 1000 Jahre, werde ich berühmt, werde ich nicht berühmt, – gehen sie vorüber, sterbe ich, lebe ich. Das sind merkwürdige Sachen. Ich habe damals Bilder gemalt, ich habe immer wieder mal Bilder gemalt, an denen habe ich drei Monate, vier Monate gemalt, und dann hat meine Frau so ein Bild von der Staffelei eines Tages genommen, während ich malte, und hat es aus dem Fenster geworfen, weil sie’s nicht mehr mit ansehen konnte. Da bin ich runtergegangen und habe das Bild wieder raufgeholt und hab es mir ganz stur wieder hingestellt und habe eben weitergemacht. Ich glaube nicht, daß irgendwelche Ereignisse, politischer oder wirtschaftlicher Natur; einen Einfluß auf diese künstlerischen Anlagen haben können.
Über die sogenannten ›Scheibenbilder‹ ab 1954:
So fing ich mit sehr harmlosen neuen Versuchen an und stellte fest: Wenn ich mit einem Pinsel auf die Leinwand gehe, gibt es einen kleinen Klecks, vergrößere ich den, dann habe ich eine Scheibe. Diese Scheibe tut natürlich auf der Fläche schon eine ganze Menge. Setze ich andere Scheiben hinzu, so entsteht ein System von zumindest farbigen und quantitativen Größenverhältnissen, die man nun kombinieren und weiterhin zu größeren Bildkomplexen zusammenbauen könnte. In diesen Jahren habe ich mich dann bemüht, das Unternehmen dieser Scheiben-Fugen-Setzungen zu untersuchen, ob daraus ein System zu machen ist. So habe ich nur einige wichtige, grundsätzliche Punkte, vertikale, horizontale, diagonale festgestellt, Flächenwerte, positive, negative und mittlere Flächenwerte. So ergab sich z.B. fast immer, wenn sich eine Reihe kalter Farben mit einer Reihe warmer Farben zusammensetzte, die eigentliche Sache dieser Scheibenbilder. Die Farbe selbst ist immer begrenzt durch eine Form. Wenn man nicht ganz willkürlich arbeiten will, kann man nur mit diesen Farbscheiben – jedenfalls ich konnte nur mit diesen Farbscheiben weiterarbeiten.
Über das Verhältnis zu seiner Umwelt:
Ich selbst habe nicht sehr große Beziehungen zu der direkten Umwelt, in der ich lebe. Ich fühle mich hier sehr wohl und das ist sehr großstädtisch. Das Rheinland ist eine ziemliche Anhäufung von Menschen, und man hat also hier tatsächlich eine sehr urbane Situation vor sich. Nur da, wo sich die Menschen zusammengefunden haben, und die zivilisatorischen Fragen einigermaßen geklärt sind, fangen die geistigen Fragen an, weil dort auch die großen Leute und Vereinigungen sitzen, die kritikfähig sind und die auf diese Weise den Künstler inspirieren weiterzuarbeiten, indem sie von ihm immer noch höhere Forderungen erwarten. Die Entscheidungen über diese Dinge fallen immer in den Städten. Außerdem pflege ich die großen Städte zu besuchen und dort auszustellen und mich den Kritiken dort zu stellen. Und dann ist eben interessant, daß diese Großstädter oft Entscheidungen fällen, die einem Künstler nicht gerade unsympatisch sind. Selbst wenn sie negativ sind, [dann] sind sie vielleicht sehr mühselig, aber treiben ihn voran. Außerdem liebt er ja den Umgang mit den Menschen, und die Großstadt gibt ihm die Möglichkeit, auf den Straßen herumzusausen, in Cafés zu sitzen, mit vielen verschiedenen Menschen zu sprechen, so daß auch in dieser Beziehung die Urbanität eigentlich das Thema ist. Es sind ja nicht eben Menschen, die äußere Welt, und es ist trotzdem so, daß diese einfache Wirklichkeit dennoch mit hineinspielt. Ich pflege nicht zu sehen, wie die Menschen leben, was sie essen, wie sie angezogen sind, welche Sprache sie sprechen. Ich liebe Menschen sehr und freue mich, wenn Menschen leben und anders leben als ich, aber künstlerisch beschäftigt mich das in gar keiner Weise. Die weiße Leinwand nimmt ganz andere Vorgänge auf. Und zwar sind es Endsträhnen von bewußt gewordenen spirituellen und kosmischen Gedanken, die mir in fremden Landschaften und unter fremden Menschen gekommen sind.
Über das Erlebnis eines Stierkampfes:
Man saß also in dieser großen Arena, und natürlich hatte sich die Menschenmenge in den Schatten gesetzt, und auf der Sonnenseite saßen wenige Menschen. Und nun spielte sich der Stierkampf ab, alle Viertelstunde ein Stier, zwei Stunden lang, und die Sonne drehte sich natürlich. Ich merkte, daß der Schatten also herumzog, und ich erlebte zugleich diesen Stierkampf, der ja ganz bestimmte Schritte hat. Interessant ist, daß man tatsächlich beim Stierkampf jede Phase des Kampfes, wo man auch sitzt, wie nah oder wie fern, ob der Kampf direkt vor dem Platz stattfindet oder auf der anderen Seite – man erlebt es ganz genau mit den Augen und man hört es ganz genau. Der Schatten zog langsam weiter in den zwei Stunden, doch immerhin ein ganzes Stück. Und in meiner Phantasie erschien das dann so wie ein Lokomotivrad mit dem Schwerkraftgewicht, so daß sich also dieses Rund immer mit einem gewissen Schwung zu bewegen schien. So also entstand so etwas wie eine Ellipse, und in dieser Kreisbewegung spielte sich das Spiel ab, und wo es auch seinen Akzent hatte, war ein Mittelpunkt. So daß also hier der alte, merkwürdige Moment aufkam, daß eine Ellipse entstand, die sich bewegte und in der jeder Punkt Mittelpunkt war.
Über Selbstkritik und Selbstzweifel:
Mir hat einmal ein Maler sehr richtig gesagt: »Zerstören Sie gar nichts, stellen Sie’s irgendwo in die Ecke, Sie zerstören immer die Bilder, die nachher entscheidend sind.« Der Künstler kann das meist gar nicht entscheiden, welche Bilder die besten sind. Von Klee z.B. ist bekannt, daß er seine kleinen Bilder und Aquarelle mit kleinen Geheimzeichen versehen hat, und später hat man nach seinem Tode die Geheimzeichen herausbekommen – und sie sind also oft mit den Vorstellungen der Betrachter in gar keiner Weise identisch. Ein Maler hat mal sehr schön gesagt: »Ja, was ich gestern gesagt habe, das ist nicht so wichtig.« Mit Malern habe ich früher Berührung gehabt. Ich bin manchmal zu einem alten Maler gekommen, ich klingelte und da stand er in der Tür, grau und fahl. Ich sagte: »Na, wie geht’s Ihnen denn, was machen Sie?« Sagt er: »Herr, wir haben die ganz Nacht gefischt, und wir haben nichts gefangen.«