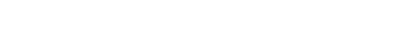Gespräch mit Edouard Roditi
Publiziert in: Edouard Roditi, Dialoge über Kunst
Wiesbaden 1960, S. 172-180
Ich bewunderte Matisse, die Farbe war mir mehr ein Element der Komposition als ein Ausdruck der Gestik. Aber ich fühlte bald, daß diese zackigen Formen, die auch für einen Teil von Kirchners Werk charakteristisch sind, sich besser für eine Art von Kunst eigneten, zu der ich mich schon vortastete. Ich brauchte Formen, aus denen sich Gesten entwickeln können.
Bedeutet das, daß Sie in Ihrem Werk ein gewisses dramatisches Pathos wiedererwecken wollten, das man in Kokoschkas Bildern oder in denen der Berliner ›pathetischen‹ Expressionisten findet?
Keineswegs. Pathos will ich in meiner Malerei gerade vermeiden. Ich will, daß sie von Grund auf dynamisch … und gegenwärtig sei. Was James Joyce mit Form und Struktur der Sprache tat, möchte ich mit den Mitteln der Malerei erreichen. Ich möchte für mich bedeutungslos gewordene Mythen durch eine Sprache ersetzen, die auf das, was über die Leinwand hinausgeht, nicht mehr Bezug nimmt. Deshalb verzichtete ich auch auf die zackigen Formen meiner frühen Werke: Bewegungen sind an sich nicht dynamisch und deuten nur die Energie an, die sie beherrscht und leitet, ohne in ihnen enthalten zu sein. Ich erkannte, daß meine Aufgabe darin bestand, Gestik in Dynamik zu verwandeln; und das mußte erreicht werden innerhalb der Grenzen der Fläche, die mir als Aktionsgebiet zur Verfügung steht.
Wie kamen Sie dazu, sich für eine so lange Zeit Ihres Lebens als Künstler in einer fremdländischen Gegend wie den Lofoteninseln niederzulassen? Der bloße Name erweckt in mir das Gefühl äußerster Vereinsamung und die Erinnerung an einen Kirchhof, den O. W. de L. Milosz, ein französischer Dichter polnischer Abstammung, in einem seiner traurigsten Gedichte beschreibt …
Ich gebe zu, im Grunde ein Großstadtmensch zu sein, ein echter Berliner. Aber am Anfang der Nazi-Ära verzichtete ich darauf, Berlin noch als meine Heimat zu betrachten. Ich suchte eine Gelegenheit hinauszukommen. Durch gemeinsame Freunde hörte der norwegische Maler Edvard Munch von meiner Situation im Dritten Reich. Ich lebte von einer Arbeitslosenunterstützung von vierzig Mark im Monat, mit dem Verbot, mir Arbeitsmaterial bei dem Händler zu kaufen, der mich seit zehn Jahren damit versorgte. 1937 lud Munch mich ein, sein Gast in Norwegen zu sein. In Oslo angekommen, suchte ich ihn auf und fand, daß seine Großmut mir gegenüber ihn, wenn möglich, noch verlegener machte als mich selbst. In seinem Haus häuften sich in jedem Zimmer Stapel von Zeichnungen, wie Makulatur aufgeschichtet. Er war sehr scheu und sprach beinahe widerstrebend mit mir. So blieb ich nicht lange, und da ich wenig Bekannte in Oslo hatte, verließ ich bald die Hauptstadt und erforschte das Land. Irgendwie kam ich auf diese entfernten Inseln und blieb dort fast zwei Jahre lang. Ich fühlte mich frei. Die einheimischen Fischer betrachteten mich als Künstler, als einen Mann mit Fachkenntnissen und mit einem, wenn auch etwas sonderbaren und rätselhaften Beruf. Man zeigte mir nicht, wie in Oslo, die Sympathie und das Mitgefühl, das man einem Verbannten entgegenbringt. Ich hätte natürlich mein Glück auch anderswo versuchen können, aber ich schreckte davor zurück, als Flüchtling zu leben wie so viele andere deutsche Künstler in jenen Jahren. Mein Temperament macht es mir unmöglich, schöpferisch tätig zu sein, wenn ich mich mit Problemen befassen muß, die nicht unmittelbar aus meiner Arbeit entspringen; ich meine die praktischen Probleme der Politik und der Ökonomie, denen Flüchtlinge und Verbannte nicht entgehen können.
Welches sind die Probleme, die unmittelbar aus Ihrer Arbeit entspringen und vermutlich auch durch sie gelöst werden?
Zunächst das Problem, die leere Fläche in etwas zu verwandeln, das eine eigene potentielle Energie annimmt. Manet hat einmal gesagt: »Plus c’est plat, plus c’est de l’art.« Dieses Dasein der Fläche, auf der ich male, nimmt während der Arbeit meinen Geist vollkommen in Anspruch. Dann bietet die Farbe mir die absolut eindeutige Möglichkeit einer direkten Übertragung der Energien, über die ich verfüge. Aber Farbe ist keineswegs leicht festlegbar. Ein Betrachter wird nicht unbedingt die formalen Tendenzen bemerken, die, gefühlsmäßig ausgedrückt, im Geist des Künstlers von den verschiedenen Farben eines Werks vertreten werden.
Es wollte mir oft so scheinen, als ob jeder wahre Kolorist für spezifische Harmonien empfänglich sei, daß aber diese Harmonien im Laufe seiner Entwicklung eine Wandlung erfahren könnten.
Ja, und diese verschiedenen Harmonien sind gewissermaßen die Jahreszeiten im Leben des wahren Koloristen, wenn auch eine Grundharmonie wohl durch sein ganzes Lebenswerk hindurchgeht.
In den letzten Jahren haben viele Kritiker behauptet, daß Ihre Abstraktionen große Massen von Blumen in leuchtenden Farben darstellen. Derartige Interpretationen Ihrer Bilder machen mich immer etwas mißtrauisch, denn sie verweisen Sie in die Kategorie von Monet, als er seine ›Nymphéas‹, oder von Gustav Klimt, als er seine Gartenszenen malte. Gewiß, jede abstrakte Komposition ist wie eine Karte im sogenannten Rorschach-Test, aber ein Kritiker, der der Versuchung erliegt, alles zu analysieren, was eine Abstraktion in ihm erweckt, erzählt mehr von sich selbst als von dem Bild, das ihm beim Untertauchen in obskure persönliche Tiefenzonen als Sprungbrett gedient hat.
Ich weiß nicht viel von den Rorschach-Testen, aber mir scheint, daß ein Bild gut ist, wenn es zu einer Menge verschiedener Auslegungen anregt. Auf dem Gebiet der gegenständlichen Kunst wären das zum Beispiel solche Allegorien, wie Hieronymus Bosch sie sich ausgedacht hat.
Glauben Sie, daß ein Künstler, dessen Werke so vielfältig ausgelegt werden können, wirklich – wenn auch vielleicht nur unbewußt – etwas ausgedrückt hat, das zu so verschiedenen Deutungen berechtigt?
Die meisten Künstler wissen nicht genau, was sie machen, und nehmen gern jede Interpretation entgegen, die sie tiefgründig erscheinen läßt und so ihrem Ehrgeiz schmeichelt. Aber Nay weiß immer, auf was er hinauswill und verlangt keine phantastische Auslegung seiner Bilder.
Und worauf wollen Sie eigentlich hinaus, wenn Sie malen?
Das habe ich schon in meinem kleinen Buch ›Vom Gestaltwert der Farbe, Fläche, Zahl und Rhythmus‹ erklärt. Wenn Sie es noch nicht gelesen habe, gebe ich Ihnen ein Exemplar. Aber zuvor die Warnung, immer daran zu denken, daß die Entstehung eines Kunstwerks nicht genau so vor sich geht, wie ich es dort erkläre. Als ich darüber schrieb, baute ich meine Theorie auf dem Verständnis und der Kenntnis der Vorgänge auf, die sich während meines eigenen Schaffens abspielen; in Wirklichkeit wird aber ein Werk durch die Transzendierung all solcher Kenntnis und Erfahrung geschaffen.
Welches sind für Sie die grundlegenden Elemente, die Ihnen das künstlerische Schaffen möglich machen?
Primitivität und Bewußtheit. Um ein Bild zu schaffen, muß ich mir zugleich des primitiven Dranges wie auch meiner ganzen Erfahrung als Künstler voll bewußt sein.
Ist es Ihrer Meinung nach richtig, zu sagen, daß Ihre Kunst auf die intensivste Art die Kenntnis ausdrückt, die Sie von Ihrem eigenen Sein und Wesen haben?
Gewiß, meine Malerei, so abstrakt sie ist, bleibt grundsätzlich eine Form der Selbstverwirklichung. Insofern ist sie, im Vergleich zur Gestik und zum theatralischen Element eines großen Teils der abstrakten Kunst der Pariser Schule, wahres ›action-painting‹.
Um mich der Terminologie von Platos Ästhetik zu bedienen, »imitieren« also Ihre abstrakten Kompositionen mehr die seelischen Bewegungen im Innern des Künstlers als Handlungen, die er in der Außenwelt beobachtet oder als möglich erfunden hat. So ruhig sie auch als Objekte sind, geben mir Ihre Bilder immer die Illusion einer Bewegung. Die Farben werden von Ihnen als Massen behandelt, und die Beziehungen zwischen diesen Massen erzeugen einen Rhythmus, eine Bewegung. Wäre das eine gültige Definition Ihrer Malerei?
Im großen und ganzen ja, obgleich ich es sicher mit anderen Worten ausdrücken würde. Eins davon stört mich besonders in Ihrer Definition: das Wort »Illusion«. Ich bin ein Gegner der illusionistischen Kunst. Ich erkläre im Gegenteil die Realität jedes Kunstwerks für ein Ding an sich, das weder auf einen anderen Bereich der Wirklichkeit hinweist noch die Illusion erweckt, einem solchen anzugehören. Meine Bilder aus den letzten Jahren haben zum Beispiel nicht das geringste mit der perspektivischen Überlieferung gemein, ich meine mit der illusionistischen Welt des traditionellen Raumes. Für mich beschränken sich die Probleme des Raumes auf die der Leinwand, die mir zum Malen dient. Die einzige Natur, deren ich mir dabei bewußt bin, ist die, welche ich gerade male, das heißt die, welche ich nicht reproduziere, sondern erschaffe.
Jedes Ihrer Bilder sollte demnach als eine Wirklichkeit in sich, als eine eigene Welt betrachtet werden.
Jawohl, und ich tauche aus meiner eigenen Subjektivität empor, indem ich Welten schaffe, die, wenn sie einmal gemalt sind, nicht mehr Elemente meiner subjektiven Welt, sondern bereits Objekte sind. Um diese Art Befreiung, ich möchte fast sagen Entbindung, zu erzielen, muß ich dem, was in mir als Rhythmus und Zeitrelation lebt, Formen und Raumbeziehungen verleihen. So stellt das Kunstwerk die Lösung dieses Wandlungsprozesses dar. Es verlangt weder Intelligenz noch Bildung, sondern lediglich eine gewisse Willenskraft, eine Anspannung des Gefühls, die Bewußtheit der eigenen Mittel und Ziele. In meinem Fall ist das Ergebnis ein Bild: ein Bild, das unabhängig und direkt aufgenommen werden muß. […]
Nach einem Tag voller Arbeit und einer Nacht voller Diskussionen war Nay noch genauso voller Energie, Vitalität und Lebensfreude wie bei meiner Ankunft. Für mich war es schwer zu glauben, daß er, wie er zu verschiedenen Malen im Laufe unserer Unterhaltung versichert hatte, ein Großstadtmensch sei, in Berlin geboren und aufgewachsen, und daß er sich nur im Bereich einer Großstadt wohlfühle. Trotz seiner Kultiviertheit erweckte er mehr den Eindruck einer Urgewalt, einer vulkanischen Kraft oder des weiten Raumes der Natur, als daß er an die Steinwüste einer großen Stadt denken ließ. Ich bemerkte dies, als wir voneinander Abschied nahmen. Nays Antwort war sarkastisch:
Natur? Wir wissen nicht mehr, was dieses Wort bedeutet. Goethe wußte es noch, Cézanne glaubte es zu wissen. Aber wer würde heute noch Äpfel in einer Schale oder die Aussicht auf provenzalische Berge malen? Auf den Lofoten versuchte ich mich in dieser Art von Malerei, ich glaube, mit einigem Erfolg. Doch würde ich höchst ungern zwanzig Jahre meines Lebens damit zubringen, immer wieder dieselben Bilder zu malen.
Würden Sie nicht auch höchst ungern zwanzig Jahre lang immer wieder dieselben Abstraktionen malen?
Sicherlich, und da liegt das wahre Problem. Was nun? Rückkehr zu gegenständlicher Kunst, zur Landschaftsmalerei, zu Blumen, Stilleben, Portraits, Allegorien, Szenen auf dem Schlachtfeld, Interieurs mit nähenden oder lesenden Frauen? Nein! Es muß etwas anderes sein.
Einige Künstler in Paris malen keine abstrakten Kompositionen mehr, sondern figurative Darstellungen der Resultate in der Atomwissenschaft.
Da haben Sie es. Heutzutage kann Natur bedeuten, was man will. Gegenständlich? Ungegenständlich? Realität? Halluzination? Wer weiß es? Wir stehen im Dunkel oder in blendendem Licht.
Mit diesem Paradox, das eines Heraklit, eines Laotse würdig gewesen wäre, schieden wir voneinander.