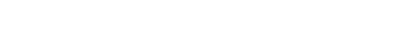Für Werner Haftmann bestimmter Lebensbericht
›Regesten zu Leben und Werk‹
Im Mai 1925 hatte ich einige Bildnisse gemalt, ich wohnte mal wieder für ein Jahr bei meiner Mutter in Steglitz in einer großen Etagenwohnung, war Angestellter einer Buchhandlung und sonntags, wie oft nachts, malte ich. Um die Ecke herum wohnte die alte Witwe eines Arztes, die sich meiner unruhigen, exzentrischen Natur, weich und gütig, entgegenkommend-mütterlich annahm. Deren Sohn malte ich eines Tages in vier Stunden. Vorher die Freundin einer meiner Schwestern und meine Mutter. Diese drei Bilder existieren noch. Mit meiner Mutter vertrug ich mich schlecht, sie war wohl kalt und herrisch. Ich malte sie einen ganzen Sonntag über – acht Stunden, dann fiel sie ohnmächtig vom Stuhl und ich ebenfalls. Sicher beides nicht nur von der Anstrengung des Malens, sondern von der inneren Spannung.–
Ich sah damals eine Ausstellung von Hofer in der Akademie der Künste. Ich war nicht bekannt mit den damaligen Kunstströmungen; meiner sofort sichtbaren Neigung zur Farbe hatte immer schon Matisse entsprochen, und so ist das dritte dieser Bildnisse ein wenig im Sinne von Matisse inszeniert. Merkwürdig dieses zusammensetzen von Olivgrün zu Kaltgrün, zu Chromoxydgrün, der Gegensatz dann von Kobaltblau zu Rosa, dazu ein gewisser psychischer Akzent, der sich auch in der Farbkomposition ausdrückte. Vorher hatte mich der ›Sturm‹ an der Potsdamer Straße angezogen, vor allem Chagall, und in jüngeren Jahren, ganz ohne den bildnerischen Komplex, Caspar David Friedrich. So scheint sich früh meine Art des Gehens bemerkbar gemacht zu haben, dieses in einem Kamin Hochsteigen, links einen Fuß, den anderen rechts, die Synthese suchend. Mit diesen drei Bildern fuhr ich eines Sonntags zu Hofer und zeigte sie ihm. Er war von dem Bildnis des jungen Mannes sehr begeistert und bestimmte, ich solle es auf die Akademie-Ausstellung am Pariserplatz geben, die Frühjahrsausstellung. Die war damals die beste moderne Ausstellung in Berlin. Zugleich wollte er mich als Schüler haben, und nach einigen Debatten, denen die Besprechung der praktischen Seite, die Beschaffung eines Stipendiums, folgte, sagte ich zu, kündigte und kam in seine Klasse an der Hardenbergstraße. Hofer hielt von meinem Maltalent sehr viel, meinte aber, die Zeichnung sei ganz unentwickelt. Aber sie war originell, eine merkwürdige Zeichensetzerei. Akte auf Stühlen, gezeichnet im offiziellen Abendakt, ganz unoptisch gezeichnet, wurden von den anderen jungen Malern sehr bewundert. Übrigens hatte ich zwei Jahre vorher schon mal Abendakt auf der Kunstgewerbeschule gehabt. Diese Akte waren konventioneller, seltsam wieso sie nachher wieder unkonventionell werden konnten, Gott sei Dank. Überhaupt sollte auch dieses Schwanken zwischen Konvention und Gegenteil lange anhalten. Auf der Akademieausstellung hing das Bild ›Franz Reuter‹ dann höchst ehrenvoll zwischen Kirchnerporträt und Kokoschkaporträt, und ich wurde vielfach dazu beglückwünscht. In der Klasse wurde Akte gemalt. Das war, wenn auch der Versuch gemacht wurde, die Flachkunst der Gegenwart einzuhalten, doch stupide. In den Sommermonaten malte ich in den Vorstädten Landschaften vor der Natur, aber nicht eigentlich optisch. Als mich einmal 1924 ein Spaziergänger danach fragte, was ich denn damit wolle, sagte ich, ich wolle im Sinne von Wellblech malen. Ich meinte, die Fläche in diesem Sinne zu bewegen. Anekdotisches in der Malerei interessierte mich nicht. Von Matisse war ich längst abgekommen. Eine Annäherung an Hofer fand noch lange nicht statt. Aber dies Wellblech hat doch wie die Anlage zur Chromatik schon früh mein künstlerisches Tun bestimmt. Es war mir zwar damals noch nicht bewußt, daß ich Künstler sei, das verstand ich erst 1928 auf einem Spaziergang, als Roesch[1] zu mir sagte »wir Künstler«. Aber die intellektuelle Beschäftigung mit dem Formalen hielt ich schon damals für eine selbstverständliche Komponente der Malerei. Die Stimmung in der Klasse war ganz interessant. Die schönen Jahre Berlins, langsam geisterte der Kubismus hindurch, gar nicht der Surrealismus, der in diesen Jahren gerade aufstieg, aber die Franzosen natürlich. Eher schon Kandinsky und weniger Klee, der damals formal noch nicht verstanden wurde. Noch war uns ja die Frage der Perspektive im genauen Sinne nicht fragwürdig geworden. Und den außerkünstlerischen Ambitionen eben des Surrealismus stand ich kühl gegenüber. 1928 dann ging ich zum ersten Mal nach Paris, kam, nachdem ich sah, was dort war, mit Begeisterung für Poussin zurück, an dem mich die kubisch-formale Konzeption reizte, denn meine farbig-flächige mußte ja mit dem Wellblech zu einer Synthese verbunden werden. Ich war nicht für Pathos, mochte den damals in 2ter Phase entstehenden realistischen Expressionismus nicht. Und als ich schließlich dann nachließ, was doch einmal nach diesen hektischen Jahren 1924-28 geschehen mußte, landete ich ganz schön und häßlich im Konventionellen. Daraus riß ich mich dann mit Gewalt los und mit dem ersten Untergang. Hieß es doch damals, Nay gräbt sich sein eigenes Grab. Das wiederholte sich des öfteren, und noch heute mag es Stimmen dieser Art geben, mehr aus Besserwisserei. Ich hatte mich also nicht nur nicht gefunden, sondern das wenige Anfängliche sogar noch verloren. Eine Proust’sche Figur – wie Roesch auch, diese gebildete großstädtische Jugend, hektisch, aber wohlerzogen, lodernd ohne sichtbare Expression. Und ich fing wieder von vorn an. In diesen Jahren 1929-31 trieb ich mehr dahin, malte wenig, und niemand fragte nach mir. Ich aber, wenn schon gefragt, wollte nur einen Apfel malen, aber nicht so wie Manet, Courbet, Cézanne, von dem ich nicht viel verstand, ihn aber sehr hoch schätzte, sondern einen Apfel, eine Wasserpfütze auf der Straße, etwas Uranfängliches. Ein gewisses surrealistisches Element machte sich bemerkbar. Exzentrisch aber entstand dann jenes Liebespaar in Umarmung, erst als Farbskizze, quasi realistisch – bekleidet, dann als Röhrengebilde auf einer sofaähnlichen Bank. Haftmann nannte das Bild später einmal: »Wo haben Sie denn Ihr olles Maschinengewehr?« Ich hatte es, als die Kunstpropaganda der Nazis in Gang kam, angstvoll zerstört. Aber komischerweise dazu zerstörte ich auch realistische Porträts, die Talent genug verrieten, wie jenes ›Blumenkohlstilleben‹, das ich 1928 malte, das existiert noch. Kleine Bildchen dann oft – bis schließlich einige festere Arbeiten sehr vorsichtig zu Tage traten. 1931/32 war ich an der Deutschen Akademie in Rom, ärgerlich, weil ich in der Schulzeit vollgestopft worden war mit den Relikten der humanistischen Bildung, für deren Vergessen ich in den Jahren 1921-25 soviel Aufregendes getan hatte. Ich malte surreale formale Bilder; wohl aber doch eigene und im ganzen Verlauf meiner Kunst durchaus einzubauende Bilder. In Rom waren es nun eben nicht die Werke der bildenden Kunst, auch nicht die der Architektur, sondern die Gesänge in den Kirchen und Klöstern, Gregorianisches, Griechisches und die frühchristlichen Embleme in den Katakomben. Scheußlich alles Römische, Caracalla-Thermen, Kolosseum, die Portraits; – dagegen das Pantheon achtend! Mit Religion hatte ich’s nie. Dazu kam ich eben aus der Großstadt Berlin. Ich war schon damals innerlich unabhängig und im Grunde monoman. Politik war wie Religion vollkommen verpönt, soziale Eingliederung sah ich nicht möglich für mich. Eine rechte Ablehnung von bürgerlichen Tendenzen, in die gerade solche Typen wie ich immer wieder hineingezogen wurden, ein wenig böse über die Berliner Tendenz, Künstler als aus den untersten Schichten kommend zu wünschen. Im Gegensatz zu Roesch und Kröhnke[2], die beide eigentlich das bürgerliche Niveau beibehielten.
1932 heiratete ich Elly Kirchner, die Modell an der Akademie war, da war nichts Programmatisches drin, das kam ganz von selbst. Und mit ihr habe ich dann die schweren und mühseligen Nazijahre durchlebt, und es war ein Segen, daß sie an einfachstes Leben gewöhnt war. Im übrigen lebte ich in Rom an Rom vorbei, wie in Berlin an Berlin. Jenes Jahr 1925, mit dem ich sozusagen beginne, war ja das Jahr, in dem der Wechsel sichtbar wurde, der nach Abschluß des Kubismus eingetreten war. Picasso, Braque gingen jeder andere Wege, Picasso ins monumental Pathetische, Braque ins eigentlich Bürgerliche, beide natürlich in höchster Form, Juan Gris wurde verehrt. Die große Ära in Paris war zu Ende, als ich hin kam, das spürte man schnell, und mit den Resten beschäftigte ich mich nicht. Das Fest war aus. Auch lag es mir fern – jenes koloniale Herumstöbern in alten Büchern über alte oder andere Länder und alte Formen, um sie zur Gegenwart mitzubenutzen. Ein wenig streifte ich Versteinerungen, wie ich als Kind eine Steinsammlung hatte. So mußte das eigene Leben das herzugeben versuchen, was zur Kunst werden konnte. Ein einzelgängerischer und, wie Westheim anfangs meiner Lautbahn meinte, ein eigenbrötlerischer Weg mit vielen komischen und skurrilen Abwegen und Abzweigungen, die aber in der Großstadt unprovinziell aussahen.
Einmal ein Erinnern irgendwelcher Lebensformen aus jener Kindheit, die durch einen Krieg, Inflation und eigene Befreiung so gut wie ganz versunken war, eben durch die Steinsammlung oder ein amüsantes geologisches Buch. An protestantisch Religiösem als Kind übersättigt, war von Religion eher Negatives zu erwarten. Der Apoll von Tenea hatte mich als Kind in Erstaunen versetzt, eine Gipskopie auf der Schule. Zur Überraschung eines leidlich vernünftigen Lehrers beschäftigte mich aber auch Geologie, das Kosmisch-Phantastische darin! Das wurde dann wohl C. D. Friedrich, aber die abgebrauchte Formsprache seiner Kunst war unhaltbar uninteressant. Das waren – nach dem ersten geglückten Versuch in der Malerei in der Kunst um 1925 – die Erwägungen, die am Schluß derjenigen Zeit standen, als ich endlich den Weg meines Lebens noch einmal beginnend der eigentlich eigenen Aussage entgegen zu gehen schien, etwa 1931/32. Aus Rom 1932 zurückgekehrt nach Berlin, begannen schon die schweren Zeiten. Bilder, die keine zu sein schienen, wenige überhaupt – eine brache Zeit! Ein erster scharfer Schlag ins Afrikanische hinüber – Schmidt-Rottluff besitzt ein solches Bild, das er mir in der Nazizeit abkaufte und das er noch besitzt. Bis dann erste Zeichen von Tierformen, liegende Kühe aus der Natur gesehen, ins magische Bild verwandelt, zu größerformatigen Bildern führten. Da begann dann die Nazizeit. So war denn die Periode, die beginnt mit dem Wunsche einen Apfel zu malen, zu Ende gegangen. Das rationalistische, intellektuelle Hinzufügen von Inhalten hatte die Malerei als solche verkümmert. Das war wohl der Hauptsinn. Denn nun brach die Malerei als wilde Flächenkunst, als stille magische Zeichenkunst wieder hervor. Sie – so sagt man heute – ähnelte in etwas der Kunst Kirchners, was ich nicht so unbedingt behaupten möchte. Es gab dann diese Rohrfederzeichnungen aus Vietzkerstrand[3], wo wir höchst primitiv die Sommer zubrachten, Elly und ich, in denen ein Klang von urchristlicher Gemeinschaft aufleuchtete. In jenem fahlen Licht, das das Meer oft an Nachmittagen zeigt. Das waren große Formate zumeist. Die Leinwände eigenhändig präpariert, dazu die Farben selbst gerieben, weil ich sie nicht kaufen konnte, später aber auch, da ich nicht als Maler geführt wurde, nicht kaufen durfte. In diesen Bildern und in einigen Dünenbildern tauchte jener Komplex von Urformen in Verbindung mit Rhythmus und Dynamik auf der dann das eigentliche formale Thema meiner Kunst im Ganzen werden sollte. Ich zeichnete ein Thema auf kleinen Papieren, hundertmal; heftete diese Papiere wie zu kleinen Büchern zusammen und ließ sie liegen, bis sich da ein Bild formte, Farbklänge auftauchten, und dann setzte ich das Bild in großen Farbflächen ruhig hin, in einer immer größeren persönlichen Einsamkeit. Diese Zeit war ein starkes Einatmen gegen jene Zeiten des Ausatmens, ein Rhythmus, der sich wiederholte und wiederholt. Die Tempi wurden zuweilen sehr kurz, Ungenügen mit Errungenem stellte sich oft ein, Lust am Erfinden, wobei in der Abschnürung von der Öffentlichkeit, der Umwelt, zugleich die Gefahr der Verhedderung in eigenes Spinnen gefährlich werden konnte. Die großen Formate sollten wohl etwas aufhelfen und Luft geben. Schwer war es oft, die eigentliche Farbfläche unillusionistisch zu finden, besonders die Himmel machten Schwierigkeiten, bis ich dann eben mit diesen Himmeln anfing, das Bild anging, und dann wurde es richtiger. Es ist immer wieder das Verhältnis zur Fläche, das die Qualität der Kunst bestimmt.
Jene kleinen Bilder, die ins Surreale hinüber deuteten, kaufte zu Beginn der Nazizeit vor allem ein unbekannter Sammler, Herr Stahl, der mit Glocke und gelbem Trenchcoat stotternd um den 1. des Monats vor der Tür stand und dann so ein Bild um eine mehr als bescheidene Summe mitnahm. Er muß etwa 40 Bilder von mir besessen haben, die ihm alle durch Bomben verbrannten.
Hatte ich im Anfang meiner Kunst eine Flächenfarbe die später zu realistischer Kunstform ausschwang, im ›Blumenkohlstilleben‹ etwa, so nach diesem realistischen Einbruch einen Prozeß der Verwandlung vom Thematischen her, Wassertropfen, Steine usw., dann brachen das große Bild und die Malerei wieder durch, nunmehr mit jenem beinahe urchristlichen Ton in den Fischerbildern, vorher in der magischen Formel von Tierzeichen. Diese Verwandlungen hatten alle insgesamt erst dahingeführt, daß die erste ganz eigene, aber auch im gesamten Kunstsinn der Zeit zu sehende, ganz eigene Bildform hervortrat. In diesem Moment 1936/37 lud mich Edvard Munch nach Norwegen ein. C. G. Heise hatte an ihn geschrieben, bewegt von der so außerordentlich beschränkten Lebensmöglichkeit, in der ich mich schließlich befand.
Kurzer Bericht des Norwegenaufenthaltes! Ich fuhr also nach Oslo, ging dort am nächsten Morgen zum Rechtsanwalt Stenersen, bekam einen Kronenscheck und die Bemerkung, auf gar keinen Fall Munch zu besuchen, da er alt und krank sei. Am nächsten Morgen machte ich mich nach Skøjen auf eingedenk der Bemerkung Heises »Wehe, wenn Sie nicht Munch besuchen«, stand vor der Gartenpforte, er kam mit zwei Hunden, ich machte mein Verslein, er schnaubte sozusagen Wut, ließ mich dann ein, und wir saßen auf der Bank im Garten, gesprächsweise, aber da beide auf der Bank geradeaus sahen, sah jeder nach dem anderen, um zu sehen, wer der sei. Ein begabter Mann, ein souveräner Mann. Nicht sehr groß, blaue Augen, starkes Kinn, erzählte er die Konzeption der chinesischen Kunst. Der, ich muß schon sagen, immerwährend trockene Berliner, der ich nun mal war – sah sich »den Mann an«. Nicht eigentlich begeistert, das liegt Berlinern nicht, sah ihn sich an. Dann im Haus herumgestochert, Bilder angesehen, einen Haufen Graphik, der als Haufen in einer Ecke neben dem Flügel lag. Munch benutzte seinen Spazierstock, um die Graphiken aus ihm herauszuheben und zu zeigen. Komisch – er wußte nichts von mir, ich aber unterhielt mich gut mit ihm. Die souveränste Erscheinung, der ich je begegnet bin. Erst Calder hat mir Ähnliches suggeriert. Aber es war ein Unterschied. Munch spielte ja noch alles aus, wovon heute die Bürger in Europa immer noch träumen. In Deutschland ist es Schmidt-Rottluff, der ähnliche Empfindungen, doch anders gefärbt, erwecken konnte. Dieser sehr von mir verehrte Künstler, der verehrt wurde, weil er einfach sich selbst immer nachgab, was zu Boden fiel, was es auch war. Bis er mich persönlich ärgerte, und seine sächsische Pfiffigkeit unser Einvernehmen störte. Zur Bewunderung tauge ich natürlich nicht. So sagte ich zu Munch, bei meinem zweiten Besuch: »Meinen Sie, daß ich hier herkomme, weil Sie ein berühmter Mann sind?« Mußte er lachen! Aber ich war ehrlich wütend! Ich lebte damals jenes liberale Leben, das ich heute noch lebe. Wo wollte man mich einordnen? Immer ging ich meinen eigenen Weg. Und die bürgerliche Komponente galt nichts. Einmal 1. Klasse, dann 4. Klasse, abwechselnd ohne Umstand. Elly war genau so – wiewohl sie bei der ersten Klasse an Verschwendung dachte. Aber die 3. Klasse, die Mitte, konnte ich nie recht. Das war also Munch, mit dessen Kunst ich gar nichts zu tun hatte.
Dann die Lofoten, als Gast von Munch von der Familie Sverdrop reizend empfangen und gastlichst bewirtet. Hatte dann für vier Wochen Lust, noch einmal anders dort zu leben, ging nach Eggum am Eismeer zu einem Lehrer ins Quartier, komisch, sehe beide, ihn und seine Frau, ganz photographisch genau vor mir. Ein einstöckiges Holzhaus, in dessen Dach ich hauste. Bei Sturm klirrte das Haus in Ketten, es war angekettet an Felsen! Die Möven flogen bei Sturm durch Tür und Fenster, zu essen gab es Fisch, Kartoffeln und eingelegte Preiselbeeren, dazu Flatbröd-Matze. »Du skall komer danze«, riefen abends die Mädchen des Ortes und ich ging in der Mitternachtssonne ans Meer tanzen auf dem Anger. So schön waren die Mädchen nicht, auch kenne ich dörfliche Verhältnisse und weiß, daß man für vier Wochen schnell etwas oder gar nichts sagen muß. Aber da gab es den Ladenbesitzer, das Zentrum des Ortes. Dort geschah das tägliche Leben. Eggum – Eckum – hieß der Ort am Eismeer. Die Frauen auf den Schiffen!! – Aber doch gab es bei Sverdrops in Reine/Lofoten reizende Mitternachtsfeste an Forellenbächen mit Musik und netten Mädchen. An einen solchen weiblichen Troll kam ich, es war beiderseitige Enttäuschung. Tor und Türen der Häuser waren unverschlossen. Frauen auf dem Meere, und Kapitäne! – das war witzig. Und dasselbe Thema ist weniger witzig auf dem Festland. Aber auf dem Schiff ist der Schiffsgast I. Klasse mehr als der Kapitän, neben dem ich saß beim Mittagsmahl – mochte ich nicht, denn bei bewegter See gehörte viel dazu, als Reisender neben dem Kapitän gute Miene zu zeigen. Ich weiß noch, daß ich mich sehr ungeniert benahm. Auf den Landeplätzen war es sehr à la Munch, die weißgekleideten Mädchen am Kai, der Nebel, die Weite und Stille. Hamsun und Munch haben das alles, was der Welt unbekannt war, weil sie nie dahin kam, naturalistisch geschildert. – Ich sehe alles vor mir. Jene magische Luft, den Kai, die Landungszeremonie, die Anker, Lastbäume, Bevölkerung, Mädchen, lassen wir mal: je höher in den Norden je freier die Moral. Das erschien mir sehr verständlich. Schließlich landete ich in Kirkenes, Halbtag Aufenthalt, Hafen, Kai, das große Einkaufshaus, das einzige Hotel. Alles träge, müde, verschlafen, dort gleich das Meer, uferlos bis zum Nordpol, hier so etwas wie Lebenswärme, Drugstore, Heilsarmee, Mädchen in weißseidenen Shorts mit silbernen Fußnägeln und manikürt. – Ab Tromsoe nordwärts! Fand ich natürlich charmant.
Nochmal also anschließen an 1936! Ich hatte da einiges erlebt mit den Nazis, jedenfalls war es gut, daß ich mal für drei Monate draußen war. Dann entstanden aus den Aquarellen, die ich auf den Lofoten machte, Bilder, die Lofoten-Bilder. Die großen dynamischen Schwünge der Landschaft, ihre elementare Kraft brachten zum ersten Mal das Thema meiner Kunst hervor, die Dynamik und das Elementare. Es gab damals eine Reihe sehr guter Bilder, 1936, 1937, 1938. Die Dynamik und das Elementare. Das wurde dann ein langer Weg. Der Weg eines skeptischen Einzelgängers. der seinem dunklen Trieb mit dem Verstand zu folgen versucht. Vorneweg aber liefen die Bilder, so daß es schwer ist, den Verfasser dieser Bilder zu befragen. Er befragt sich und befragt sich nach der Arbeit, nicht vorher. Der Krieg kam, schließlich zog ich ein erträgliches Los, wurde Kartenzeichner in einem Stab. Obergefreiter. Ich hab’s nie weiter gebracht, ich war allzu unmilitärisch. Ich konnte sogar zuweilen malen in Frankreich. Es entstanden Aquarelle, Gouachen und später auch Bilder. Es kamen glückhafte Malereien zutage, fern aller Tages- und Kriegsfragen und doch nicht idyllisch. Was die Welt am wenigsten wissen will, Güte und Liebe, wurde Zuflucht und Poetik. Ich habe nur vieles einfach nicht begriffen, es gelangte nicht zu meinen Ohren, nicht in meine Seele. Es war dies ein Schutz für mich. Ein aufgescheuchter Individualist, der maskiert war. Ich liebe es ohnehin nicht, mich zu decouvrieren. Die Maske ist ständiger Bestandteil. Aber so überwinde ich den Zynismus in mir und bleibe natürlich. Dort in Frankreich war’s schöner als im damaligen Kriegs-Deutschland. Das wurde langsam grotesk! Ehrgeizlos versuchte ich, mit einem gewissen Anstand diese Jahre zu durchleben. Das Nicht-Zuhören war bei mir immer sehr ausgeprägt, ich lebe gern für mich – jedenfalls ein wenig abgeschirmt nach außen. Empfindlich wie Künstler sind, konnte ich immer irgendeine Attacke erwarten. Es kamen noch genug und selbst jetzt bin ich Dummköpfen ausgesetzt. Eine Liste der Beschimpfungen, die mir zugefügt wurden, wäre nur deshalb geschmacklos, weil es kein einziges Schimpfwort gibt, das man gegen mich nicht gebraucht hätte. Aber all diese Bösewichte, auch die letzten, die es im Augenblick noch gibt, werden sich schämen müssen. Aber ich will hinzufügen, daß es wenig Künstler gibt, denen es je anders ging, und wehleidig bin ich nicht.
Die Dynamik und das Elementare! – In jenen Nazi- und Kriegsjahren waren einige Freunde um mich herum, die ein wenig aufpaßten, daß es nicht zu schlimm wurde. Später, nach dem Krieg, war die einzige Großstadt Deutschlands zerstört, ich ging in westliche Provinzstädte, und selbstverständlich kamen dann Intriganten, Schnüffler und Klatschbasen, die um so lauter wurden, je mehr ich sie belachte. Jetzt ist das wohl endlich vorbei, allerdings mußte ich erst massiv werden. Überhaupt wünsche ich wohl, daß andere anders leben als ich, und erziehen will ich niemanden. Ich hoffe, daß mein ganzes Werk in seiner Vielfältigkeit den komisch-tapferen Weg eines, der auszog das Fürchten zu lernen, zeigt. Ohne die biedermeierische Interpretation allerdings.
Tatsächlich habe ich noch nie im Gefängnis gesessen. Fand Günther Franke eines Tages fast skandalös. Ihn hatten die Amerikaner in München für drei Monate eingesperrt, weil sie ihn bezichtigten, daß er Kunstwerke vor ihnen verbergen wolle.[4] Nun, später waren die Amerikaner die ersten, die Frieden stiften wollten. Und noch heute und weiterhin die einzigen, die vorurteilslos Frieden halten.
Jene Bilder aus dem Krieg, die Periode vor der Hekatezeit, waren eigentlich etwas Einmaliges in meiner Kunst; sie waren aus persönlichen Erlebnissen, an die ich mich klammerte, da ich alles andere nicht verstehen konnte, entstanden, eine Konstellation, die es in meiner Kunst sonst nie gab. Vom politischen und Kriegsgeschehen verstand ich wirklich nichts, ich war der Lahmsten einer als Soldat, gar keiner eben. In meinen Gedanken lebte eine Welt, und wo ich konnte, ließ ich sie zu Bildern werden. Nur selten gab es dabei besondere formale Unternehmungen oder intellektuelle formale Bemühungen. Viele träumerische Gouachen gab es damals – (siehe Klee-Tagebuch, aber komischerweise war’s genau so!) – in Tischschubladen gemalt, man saß ja oft untätig im Zeichensaal herum. Niemand störte mich. Die Kameraden interessierte das nicht.
Den Kriegsschluß erlebte ich mehr als glimpflich. Schon am 21. Mai 1945 war ich mit Lastwagen, entlassen von den Amerikanern, in Hofheim/Taunus angekommen und fand Frau Bekker in ihrem Garten vor. Nach einiger Zeit konnte ich das Atelierhaus am Kapellenberg beziehen und malte dort. Die Hekateperiode. Da kamen wieder sehr starke formale Ideen zum Vorschein, die sich mit mythisch-magischen verbanden. Bilder, dick gemalt, die von Jahr zu Jahr, je älter sie werden – um so schöner werden. Wo ich ihnen begegne, bin ich davon entzückt. Aber ich bin ein Mensch der Gegenwart, den die Gegenwart auch in seinem Leben bestimmt.
Das bildnerische Tun, die Stufen meiner Entwicklungsperioden sind so entstanden und abgelaufen. Ich war nie bemüht, mich zu wiederholen; war die Uhr abgelaufen, so war sie es. Trotzdem ist das Ganze ein geschlossenes Tun, was kam danach? Eine Kleinbilderperiode strenger, beinahe spätkubistischer, figurativer Bilder. Eine formalistische Einengung, ein mir wohl damals notwendig erscheinendes Nachholen, nicht so sehr des Kubistischen, das nicht, sondern Nachholen der intensiven Durcharbeitung einer Disziplin. Man kann mein Werk vielleicht so sehen, daß Perioden der Synthese in einem glücklichen Zeitabschnitt mit Perioden intellektueller Formulierung unterbrochen wurden, die aber heute wie notwendige Pausen anmuten. Und die Idee, wie sie sich heute daraus ergeben hat, war eben, in einem Kamin hochzuklettern, links die Intuition, rechts die formale Reflexion. Zuweilen Plattformen der Synthese mit dem imaginären Ziel, einmal die eigentlich ganze Synthese auszulösen. Ich sehe mein Leben wie eine Leinwand, statisch im Ganzen über eine Lebenszeit hin und dynamisch im Statischen zugleich – den Entwicklungsgang gehend. Dieses Gehen und dieses Atmen, Gehen – Stehen, Einatmen – Ausatmen, eine Choreographie des Rhythmus und Takte der Fläche. Dies Vermögen von der Farbe her allein. Manche Bilder haben dabei etwas von Uhren-Tachometern, sie scheinen zu ticken. Eine neue Vorstellung von Raum zugleich und von Zeit. Eine Vorstellung, die Raum und Zeit zu einem Gebilde macht. Und immer ein Realisieren, nie ein Reflektieren. Immer etwas, das vom Auge her im Ganzen erfaßt werden kann, wenn man das Auge nicht ganz als optisches Werkzeug verstehen will. Nach solch einer formalen Verengung brach wieder alles explosiv auf, aber auch das wurde nicht expressiv, sondern rhythmisch. Schwierig ja ist die Frage um die Illusion in der Malerei. Die beste Kunst ist unillusionistisch. Bewegung illusionistisch darzustellen ist billiger Naturalismus. Aufregend für mich und absolut nervös machend jener andere Bewegungsversuch mit Illusionsgestik. Der Mann, der zur Apfelsine greift (Marées), sie nie bekommt, auf großen Werken etwa bei La Tour aber der Holzspan, der spiral am Boden liegt, das Thema der Bildbewegung anmeldet, dem, der sie deuten kann, das Thema der Bewegung angebend. Das Pferd des Marc Aurel, das Pferd Rodins, der Illusionswert gegen die Statik, das ist wohl alles sehr anders, als man es zu sehen gewöhnt ist.
Schöne barbarische Nomadenlieder des 20. Jahrhunderts
Die neuesten Bilder 1956-1958
Ein Psalmensänger in unserer Zeit
Vielleicht ist es das, was Chagall kürzlich veranlaßte, mir Grüße zu bestellen und sagen zu lassen, er möge mich kennenlernen. Und der Erfolg in USA mag ähnlichen Grund haben.[5] Tatsächlich liebe ich die Psalmen sehr. Die alttestamentarische protestantische Jugend zu Haus und in Schulpforta, dort mit Humanismus verbunden! – Meine Liebe zur Wüste! Nicht die moderne Psychologie, sondern mehr, Umfassenderes. »Ich hebe die Augen auf zu den Bergen, von denen mir Hilfe kommt« – »Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat« – und das schöne Luther-Deutsch »Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er führet mich zu einer grünen Au«. In Frankreich fragten mich die Mädchen, ob ich Pfarrer sei. Vielleicht auch, weil ich so einfach nicht gelagert bin. Große Liebesgeschichten, umfassend vom Geist her bis zum Exzeß, die hatte ich wohl. Genug davon! –
Die Bilder ›Königin auf dem Thron‹ oder ›Der Engel‹ – oder ›Vier Frauen‹ und alle jene Bilder aus Frankreich, der ›Garten des Herrn Térouanne‹–, diese in der Stärke der Empfindung und die jetzigen in der Stärke der Form – ohne Sentimentalität, ohne Pathos, ohne heroische Haltung. – Ich schätze Saint-John Perse, Exupéry, Pound und Joyce vor allem. – Nach außen zeige ich das alles kaum. Ein Psalmist! – Aber man komme mir nicht mit Frömmigkeit, Religion, Kirche oder Politik.
Die einzig bildnerische formale Leistung der letzten 20 Jahre liegt in Klees spätesten Bildern, den Lineamentenbildern. Nur Michaux[6] sagte als einziger, daß in diesen Bildern die Fläche durch die Linie bewegt würde. Und so bin ich auf dem Wege, die Fläche durch die Farbe zu bewegen. Die Welt, auch die Welt der Fachleute, sieht das nicht und erkennt nicht das Einmalige und Besondere dieser Aufgabe. Man glaubt, das sei gesponnen oder phantasiert. Nein, die Kunst in den Augen dieser Leute bleibt immer noch voller Pathos und Sentiment oder Illusionismus. Und die Müdigkeit gegen die europäische Kultur läßt das Kunstwerk zum psychischen Test herabsinken oder zur naturalistischen Illusion.
1952, nach der strengen Einengung, gab es eine starke Auflösung der Bildformen. Doch ist für meine Kunst eine formale Objektivität immer eine direkte Forderung, immer mehr kam Rhythmus zum Austrag – Rhythmus der Fläche. Das Thema des Flächenraums, das eigentlich immer konstant gleich geblieben war, wurde im Sinne elipsoider Scheinvorgänge gedacht. Hier ganze und eindeutige Klarheit für das Bild zu schaffen, hat mich jahrelang beschäftigt, und die Wandlungen habe ich besonders aufmerksam nach diesem Gesichtspunkt hin beobachtet. Vom Wellblech zum flachen Illusionsraum des Realismus, zum Fernraum, schließlich zum Relief-Wellblech zurück in den Lofoten-Bildern. Die Betonung der Negativformen hatte viel zuwege gebracht. Die Hekate-Bilder gingen mit diesem ganzen Formarsenal frei und poetisch, flächig-ornamental um. Dann kamen strengere, tiefere, systematische Erwägungen. Die Spannungen, die Energien der Fläche, der Farbe, von Farbe zu Fläche, führten zu ganz anderen neuen Bildvorstellungen, Gesang, Tanz der Fläche, wenn man will. Noch einmal gab es eine höchst intensive Betonung des farbig Konstruktiven, in dem ich die Scheibe als potentielle Energieform anwandte und mit ihr die Flächenchoreographie begann. Das war nun entscheidend. Setzen wie ein Tonsetzer, ohne zu wissen, was das Bild hergeben würde und hergeben könnte.
Es ist immer die mythisch-magische Welt, die Transzendenz des Chthonischen, die nun in den Bildern der letzten Jahre aus der Formsprache der Farbe direkt emaniert. Daher Nomadenbilder oder Psalmen-Ähnlichkeit. Es ist nie ein Spirituelles oder ein Reflexives, eher wie ›spirituals‹ der Neger. Aber der Charakter ist der des heutigen Europäers, des Weltbürgers und Nomaden, der nichts mehr außer sich selbst anzuerkennen, zu erkennen vermag, so daß es auch gleich ist, wo er sich gerade befindet. – Fischerbilder – Lofotenlandschaften – Hekate-Bilder – Nomadenbilder und Psalmen. Zwischen diesen einzelnen, die doch sehr deutlich eine bestimmte Anlage und Persönlichkeit aussprechen, sind Perioden der formalen Betätigung eingestreut. So könnte sich die ganze bisherige Entwicklung folgendermaßen darstellen:
1925 Anfang Talententwicklung
1925-29 Talententwicklung
1930-32 erste Inhaltssuche
1932-34 erste mythisch-magische Form-Bilder – Tierbilder
1934-36 Fischerbilder – mythisch-magisch
1937-38 Lofoten-Bilder – Form – Landschaften mit Menschen,
Poetik aus dynamischer Formel – mythisch-magisch
1938-40 mythische Poetik (realer)
1945-50 Hekate-Bilder (abstrakter)
1950-52 kubisch formale dynamische Bilder, betont formalistisch
1952-54 ekstatische rhythmische Bilder
1954-56 formale choreographische Farbscheibenbilder
1956-58 vollchromatisch klingende Nomadenbilder, Psalmenbilder
Die Einheit des Formalen mit dem Intuitiven ist im Wechselgang in verschiedenen Stufen vollzogen. Bis zum jetzigen Übereinstimmen in bisher abgewogenster und umfassendster Entsprechung. Die experimentellen Perioden wurden nie ins Absurde zu Ende geführt.
Die Langeweile meines Lebenslaufes wird wohl notwendig sein:
Also: 11.6.1902 in Berlin geboren. Vater Johannes Nay, Berlin, damals Regierungsrat, später Geheimer Oberregierungsrat und Vortragender im Reichsschatzamt. Sehr protestantisch fromm, sichtlich sehr begabt, neben dem Beruf starke soziale Interessen. Von ihm wurden zwei noch heute bestehende Einrichtungen erfunden. 1.) Branntweinmonopol. 2.) Die Trinkgeldregelung der Kellner, die heute noch gilt. Ein hochgewachsener gutaussehender Mann aus einfacheren Verhältnissen bei neun Geschwistern sich selbst hochgearbeitet, hatte er eine glänzende Laufbahn gemacht. Fiel 1914 in Belgien als Hauptmann der Landwehr 52-jährig.
Meine Mutter: Elisabeth geb. Westphal. Die Familie großbürgerlich, wohlhabend, ihr Vater Landgerichtspräsident, Exzellenz, ein von allen bewunderter Mann aus Magdeburger Bauernherkunft, nomadisierender Beamter. Ich hatte 6 Geschwister, ein Bruder ein Jahr älter als ich, tot, zwei Schwestern ein und zwei Jahre jünger als ich, zwei Schwestern erheblich jünger, eine davon tot.
Gymnasium Steglitz, 1921-25 [hier irrt Nay; es waren die Jahre 1915-21] bis Abitur Schulpforta. Dann Buchhändlerlehrling. Geplant war Lektorenlaufbahn, Verlag. Ich schwenkte bald ab auf die Kunst zu. Abendakt in der Kunstgewerbeschule in Berlin. Wechselvolle Existenz bis 1925 in Berlin, 1928 erstmalig in Paris, 1937/38 nach Norwegen, 1931/32 an der Deutschen Akademie in Rom. Diverse Preise, Auszeichnungen etc. 1940-45 Krieg, 1945-51 Hofheim/Taunus, ab Dez. 1951 in Köln, 1932 mit Elly Nay geb. Kirchner aus Berlin verheiratet bis 1949, dann ab Dez. 1949 mit Elisabeth Kerschbaumer aus München.
Orden und Ehrenzeichen: keine.
Titel: keiner, da ich mehrere Angebote, eine Professur zu übernehmen, ablehnte, einmal um frei zu sein, dann weil Unterrichten Kraft und Zeit raubt, auch sinnvoll kaum noch erscheinen kann im Individualismus unserer Zeit, dann um das Risiko des Lebens willen und wegen der Albernheit des Titels in Beziehung zu einem Maler. Berlin, Düsseldorf, Hamburg, etc. fragten an.
In Hamburg 1952 zwei Monate Gastdozentur. [Hier irrt Nay. Es war 1953.]
Ein kleiner Versuch einer aphoristisch gehandhabten Gestaltlehre der Farbe kam im Prestel-Verlag heraus.
Eine jeweils direkte Beziehung von Leben zu Werk gibt es ja bei keinem Künstler. Ein Grundkomplex, aus dem Leben und Kunst immer wieder genährt werden, ist von Anfang an in jeden gelegt, dann erhebt sich darüber Befreiung und Konzentrierung. Eigentlich also gibt es keinen Künstler, der nicht seine Lebensherkunft, den Akkord seiner Jugend entweder bewußt weggelegt oder unbewußt entwickelt hat. Wie das bei mir ist? Alles ist ins Prinzipielle erhoben, ins Abstrakte, ins Losgelöste. Von einer direkten Übernahme kann gar keine Rede sein, Konventionelles ist ohnehin nicht dabei. Das Alttestamentarische-Protestantische, nicht als Religion, sondern als Art des Lebens, sehr häufig ja bekannt in amerikanischer Fassung, scheint vereint mit früher Anregung durch das Griechisch-Archaische irgendwie immer wieder ins Spiel gekommen zu sein. Das eigentlich Humanistische ist nicht zum Zuge gekommen – wie etwa bei Braque. –
In einem Zeitpunkt, in dem ich versuche, die Bilder so weit zu treiben, daß sie aus der Klarheit der formalen Konzeption ausschwingen in eine bildnerische Poetik, ist es noch angebracht, so lange bei diesen Scheiben zu beharren und sie noch von verschiedenen Seiten her zu analysieren. Der in den Lofoten-Bildern sich zeigende Komplex des Dynamischen mußte ja einmal von Grund aus durchdacht werden. Dabei stellte sich als erste Feststellung natürlich heraus, daß die Fläche statisch ist und bleibt! Die Illusionsbewegung konnte, wenn sie künstlerisch war, mehr eigentlich Gestik genannt werden. Diese konnte eine Verbindung mit dem Rhythmus eingehen und irgend einer Art von abstrakter Figuration. Dann war die motorisch-funktionelle Bewegung zu analysieren, diejenige, die der Film benutzt. Diese motorische Funktion ist materiell und intellektuell. Abläufe konnten nur willkürlich intellektuell erfunden werden (Eggeling). Einmal hatte ich einen kleinen abstrakten Film gezeichnet, da hatte ich sogar jene funktionelle Motorik unintellektuell formulieren wollen. Machte ich nun einen farbigen Punkt auf eine leere Fläche, so entstanden im gleichen Augenblick eine erstaunliche Anzahl von Spannungen. Im Punkt selbst richtungslose, von ihm zur gesamten Fläche bestimmbar relative, dann Farbe zur anderen Fläche. Breitete ich den Punkt aus, verstärkten sich die Spannungen. Eine zweite solche Scheibe, eine dritte, eine vierte – alle gleich groß, ergaben schon eine höchst komplizierte Formrelation. Auch entstand dabei eine Mehrzahl von Farben, wenn ich jeder Scheibe eine andere Farbe gab, das konnte als chromatische Reihe angesehen werden. Die Zwischenräume ergaben Formen, und diese konnten ganz mechanisch mit den gleichen Farben in einem bestimmten Wechsel zu einer Wellblechflächengestalt entwickelt werden, so daß eine Verzahnung geschah. Nun konnte eine Reihe kleinerer Scheiben in den gleichen Farben hineingearbeitet werden, farbig reziprok mit gleichen Negativverzahnungen. Wieder ergaben sich abstrakt figurative Veranstaltungen. Diese Art, ein Bildganzes zu versuchen, ermöglichte unendliche Variationen. Darin lag allerdings für die eigene Seele eine unheimliche Gefahr, die oft genug aufblitzte. Die Monomanie konnte sich krankhaft steigern. Dem nachzugeben wäre vollkommen undenkbar gewesen; es gehört wenig Kenntnis der Psychoanalyse dazu, um das zu verstehen. Man würde ja die drängende Kraft jeder Spannung beraubt haben, und Bilder hätten nicht mehr entstehen können. Später konnte diese Scheibe noch erstaunliche Empfindungen emanieren. Natürlich wurde in der Öffentlichkeit von Stumpfsinn, Blumen und Ballons gesprochen. Ich aber hatte eine Primitivform in der Hand, die sehr wohl geeignet war, sowohl dem hohen geistigen Anspruch einer neuen arithmetischen Bildform als Lebenssinnbild zu dienen wie auch den elementaren Kräften der Natur des heutigen Menschen Aussage zu verschaffen. Jene Synthese wurde dadurch möglich, und sie geschah auch, die Synthese, die eigentlich Kunstwerk ist, eine körperlich, geistig, seelische Synthese mit einer dem heutigen Menschen zugänglichen Aussage, die nichts anderes enthält als den Menschen selbst, nichts außer diesem, kein Außen im transzendenten Sinne, im religiösen Sinne, sondern ein Außen und Innen, einen Körper und Geist zugleich. Wie immer hatte ich das Talent, jene formalistischen Experimente nur im Großen zu veranstalten, ohne die Absicht, sie bis ins kleinste Detail zu verfolgen und zu vervollkommnen. Dann hätte ich festgesessen. Irgendwann brach das Eis von selbst.
Wesentlich ist zu meiner Art von Scheibenerfindung zu sagen, daß sie rein artistischer Natur war, nichts Physikalisches enthielt, nichts von der Natur, aber wahrscheinlich jenen psychischen Komplex der Bannung von Angst enthält, auf den C. G. Jung hinweist: Untertassen. Man kann diese Angst herausschreien, wie es zur Zeit meist geschieht, man kann ihr aber auch ohne Idealismus und Pathos entgegengehen, Kreis = Mandala!
Idealismus, Pathos, Heroismus, Christentum, Humanismus, Recht, man muß sich klar sein – ob man will oder nicht –, daß die eigentliche Wirksamkeit all dieser Vorstellungen erloschen ist. Und daß die Härte des Lebens darin besteht, die frei gewordenen barbarischen Kräfte mit den geistigen und seelischen Kräften zu binden. Man kann das alles leugnen und den Kopf in den Sand stecken. Doch jeder weiß, daß unser Jahrhundert nicht von jenen anfangs genannten Kräften geleitet wurde und wird. Oder sollte die Atombombe eine humane Erfindung sein! –
Eine willentliche Absicht liegt in der Erfindung der Scheiben ganz und gar nicht. Ich bin weit davon entfernt, mich besser zu dünken als die anderen. Der Prozeß eines Kunstwerkes steht in den Sternen! D.h. ist unabhängig und ein Prozeß in sich. Und eine pathetische Haltung liegt mir fern.
Seit Jahrzehnten wird unsere Gegenwart immer wieder an die Frage herangebracht, ob Dilletantismus echte Aussage hervorbringen kann. Man kann die Frage eben doch mit nein beantworten, indem man eben doch für die Malerei unserer Zeit ein gewisses Verhalten zur Fläche und eine gewisse geistige Höhe des Stils als bindend ansieht. Man kehrt immer wieder zur Malerei zurück, allerdings zur Malerei, die je in der Zeit ein neues Gesicht, diese Zeit eben, trägt. Eine Malerei an sich gibt es nicht, das führt sofort zum Konventionalismus, aber es gibt eine malerische Kreation, die aus jeder Epoche anders erklingen muß. Diese Kreation ist immer mehr als jede weltanschauliche Manifestation, auch wenn diese als Flächenkunst sich vorstellt. –
Diese malerische Kreation ist der einzige Weg, der kein Ausweg, keine Ausflucht, kein Nebenweg ist, kein Surrogat; daher auch darin enthalten ist jene letzte und äußerste Spannung von Intuition und Elementarem, von geistiger Höhe und Elementarem zugleich. Die Farbe ist das wirklich undeutbare Geheimnis. Man darf sie absolut und ganz und gar nicht auf eine Deutbarkeit hin gebrauchen, man mißbraucht sie sofort, das wissen die wenigsten. Im Gegenteil, meistens rühmen die Fachleute solchen Mißbrauch als besonders großartig! Dieser Mißbrauch beruht auf dem alten Irrtum. daß der Künstler dazu da sei, mit seinen Mitteln, den Mitteln des Metiers, etwas darüber hinaus auszusagen. Die Mittel aber sind die Sache selbst, das Ganze bereits.
Man könnte noch jenen üblichen Versuch machen, die Anlagen des Künstlers aus den Grundrichtungen der Familie zu destillieren. Ich selbst halte nur wenig davon, aber sei’s drum: Väterlicherseits der Großvater mittlerer Zollbeamter, ein protestantisch eifernder Patriarch-Blaukreuzler, weißes langes Haar Vollbart, sah aus wie ein Prophet. War relativ primitiv. Mehrere Söhne (also Onkels von mir) Pastoren, eine Tochter mit einem Missionar verheiratet. Östliche Typen. Aber im ganzen Gehabe so halbwegs kleinbürgerliche Großstädter – etwas amerikanisch! Schwarze Anzüge – schwarze Schlipse täglich! – Viel Beterei und Kirchenlauferei! Mein Vater selbst neben aller wirklich ungewöhnlichen Begabung ein christlicher Sektierer. Puritanische Erziehung natürlich – auch in Schulpforta! Nun dieser pastorenhaften Eiferei standen die Weltleute aus Mittel- und Süddeutschland aus der Familie meiner Mutter gegenüber. Alles Bauernvolk aus der Magdeburger Börde. Mein Großvater mütterlicherseits, ein eleganter Mann mit vielen Interessen, wollte Arzt werden, war aber zu sensibel dazu, wurde Jurist. Die Familie der mütterlichen Großmutter aus Augsburg: Rosentreter. So was wie die Fugger. Zu stolz um adelig zu sein. Großartige Typen alle.
So sieht also die Komposition aus – man sagt: die gleiche wie bei Kirchner. Was besagt das schon? Nichts! –
Viele bedeutende Künstler der allerletzten Zeit sind aus großbürgerlichem Herkommen, merkwürdig, da man zu meiner Jugendzeit so sehr annahm, daß Künstler aus der Hefe des Volkes kommen müßten. Ich bleibe allerdings bei Nietzsches Wort: »Nicht woher du kommst, sondern wohin du gehst, mache fürderhin deine Ehre.« Immerhin; diejenigen echten Begabungen, die aus der großbürgerlichen Welt kamen und kommen, haben das falsche Pathos jener Welt und den Idealismus wie Heroismus höhnisch hinter sich gelassen und sind oft in Schmerzen frei geworden – und [haben] dann daraus ein ungeheures Durchstehvermögen gewonnen und eine vollkommene Unabhängigkeit gegen alles, alle und jeden. Dabei aber ein ›fair play‹ eingehalten, weswegen Leute, die das nicht einhalten, im vorherein verdammt werden. Also diese Beamtenfamilien! Merkwürdige Blüten haben die getrieben, Künstler am Schluß! Im Abstieg und Verfall eine Orchidee, die aber keineswegs dekadent ist, wie ja die Blume Orchidee auch keineswegs dekadent zu nennen ist.
Familien und Menschen steigen auf und gehen unter. Aus den untergehenden scheinen die großen potentiellen Kräfte zu kommen, aus den aufsteigenden die großen materiellen Kräfte. Die Aufsteigenden – wenn sie über den ersten oder zweiten Ansatz hinaus sind, geben ihre materiellen Überschüsse an die potentiellen Kräfte, die – weil universal – doch die stärkeren sind – und so lebt die Kunst! – Und jene wissen sehr wohl und übrigens sehr gern, daß die potentiellen Kräfte die stärkeren sind. Ein witziger Kreislauf! –
Da ist ein Foto gekommen von einem Bild – 1932 – 48 x 60 cm Hochformat, gemalt in Rom. ›Muschel und Fisch‹ oder so ähnlich ist der Titel. Bildhauer Nimptsch[7] – London. Da ist die helle männliche Welt, da die dunkle weibliche. Ein Querstrich in der Mitte des Bildes, oben weiß, im Material spürbar gemacht – unten schwarz. Da unten schwimmt ein Fisch – (Penis) – ohne Kopf! – senkrecht eine braune Muschelform – Vagina – oben ein schräger Stab – Penis – dazu Muschel in Spirale – Vagina, heißt: Definition der männlichen universalen Welt gegen die weibliche universale Welt und die Möglichkeit (schräg – Spirale) sich zu verbinden. Nett, daß der Mann-Fisch keinen Kopf hat!!! Die Ironie hat noch Platz, der Großstädter äußert sich dennoch – auch noch!
Wohl gibt es Künstler, die einmal eine Aussage machen und diese dann bis zu ihrem Lebensende wiederholend ausbauen, andere, die früh eine Aussage setzen, dann vergehen, andere, die sich immer wieder erneuern. Zu diesen gehöre wohl ich. Die eigentlich schlüssige, endgültige Aussage entwickelt sich über das ganze Leben und reift langsam heran. Die sehr wechselnde Erneuerung steigt um Stufe und Stufe höher und umfassender. Ich könnte mir kein Halt denken, keine Wiederholung oder Variation! Und doch ist der rote Faden immer sichtbar. So hat wohl jeder Mensch in seinem Labyrinth sitzend den Ariadnefaden. Wenige wissen ihn aufzurollen, die meisten sind zu faul dazu, manche auch haben einen Spinnwebfaden in der Hand statt ihres Ariadnefadens und merken es nicht. Es ist schwer, überhaupt etwas zu merken. Der Künstler versucht es, und so entstehen Merkmale, an denen man ihn erkennt. Ich las heute ein Wort von Musil: »Auch der schlechte Künstler hat gute Wünsche und Absichten.« Und so darf sich jeder für den besten halten oder besser den schlechtesten, d.h., letzten Endes lebt man sein Leben als ein Ganzes, und es geht so oder so ab. Schicksal aber ist doch eben das »daraus Etwas machen«. – Und Künstler sind ganz und gar Einzelne, Einzelgänger von Geburt und Geblüt.
[1] Kurt Roesch, Schüler bei Carl Hofer, emigrierte in die USA und war mit Nay befreundet.
[2] Luise Roesler-Kröhnke, ebenfalls in der Hofer-Klasse und mit Nay befreundet.
[3] An der Ostsee.
[4] 1945 verbot die amerikanische Besatzungsmacht, Kunstwerke zu transportieren. Franke hatte aus Sorge vor Bombenzerstörung während des Krieges ein Kellerdepot in Schwabing gemietet, aus dem er nach 1945 Bilder in seine Galerie brachte.
[5] 1955 hatte Nay in New York seine erste Einzelausstellung.
[6] Henri Michaux (1899-1984), französischer Schriftsteller, Maler und Zeichner.
[7] Uli Nimptsch, nach England emigrierter Bildhauer, mit Nay seit 1931 befreundet.