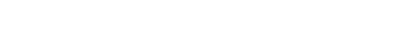Aufzeichnung vom 1.7.1956
Warum die Kugeln?
Warum die Peinture?
Warum die großen Formate?
Diese drei Fragen beantworte ich mit der Darlegung meines Systems. Denn ich arbeite anhand eines Systems.
Axiom I: Farbe und Fläche als Relation zueinander.
Axiom II: Die Fläche ist als zweidimensionale zur Erscheinung zu bringen. Der Raum als unvorstellbar und als ein Raum, in dem jeder Punkt Mittelpunkt ist – also der nicht perspektivisch meßbare Raum – gibt der zweidimensionalen Fläche die Aufgabe auf, im zweidimensional Vornstehenden der Fläche die dritte Dimension, die Tiefe, als unmeßbar, also aufgelöst in dritte und weitere unbestimmbare Dimensionen in der Schwebe zu halten. Die Fläche beantwortet also die unmeßbar unvorstellbare Raumvorstellung, indem sie das Sphärische des Raums als ohne Mittelpunkt verstanden, also wo jeder Punkt Mittelpunkt ist, sich einnimmt.
Axiom III: Die Fläche ist statisch und die Mittel, sie zu formen, sind statischer Natur. Die vierte Dimension – der gehende Raum von Raum und Zeit – ist also nicht kinetisch, sondern statisch als Fläche zu bestimmen, so daß – und sie ist auch statisch jene vierte Dimension – die dritte, vierte und weitere Dimensionen sich in sich zur Plastik der Fläche, ohne die Illusion von Plastik zu geben, auflösen. So verwandelt sich heute die Fläche zur gestalteten Fläche.
Axiom IV: Das raumillusionistische Verhalten der Farbe, das nun einmal existiert, hat kein bestimmbares Gesetz. Rot kann vor Blau, Blau kann vor Rot liegen. Wird die Fläche – von der Farbe gestaltet – nicht in der Isolierung der Farben voneinander, sondern als gesamte farbige Gestaltung verstanden, so ergibt die Relation von Farbe zu Fläche (Axiom I) die Notwendigkeit eines jeweils für ein Bild aufzustellenden chromatischen Satzes derart, daß
1) der erste Satz der Chromatik, der erste Farbsatz ungleich zu setzen ist: zwei Hauptfarben, eine Nebenfarbe, oder vier Hauptfarben, drei Nebenfarben oder fünf, also in ungleicher Reihe;
2) diese Farbenreihe, für ein Bild festgelegt, nicht verlassen werden darf;
3) positive und negative Werte als Feststellungen der Fläche – einmal als Kreisform, also chromatische Feststellung, zum anderen als offener Flächenwert, also als Fläche – sich ergeben müssen, die die Fläche im Sinne des unvorstellbaren Raums als geistige gestaltete Fläche zweidimensional zur Erscheinung bringen.
Axiom V: Der chromatische Satz hat keine physikalisch-naturalistische Grundlage. Er ist artistisch, aber festgelegt in einem ungleichen Zahlenverhältnis. Er bestimmt die farbige Gestaltung als Fläche. Um diese farbige Gestaltung als Fläche geht es. Und ich zeige als Fläche, wie das geschieht, indem ich den ersten großen chromatischen Satz in reziproken Werten mit einem oder zwei weiteren Sätzen zur Farbfuge verbinde – jeweils in reziproken Sätzen, wobei die Flächengrößen der Farben die Fläche statisch bestimmen. Daher die Kugeln und ihre Zwischenformen. Denn es gibt keinen farbigen Generalbaß, den Goethe forderte, sondern hier ist ein System der chromatischen Relationen – als Fläche – gesetzt in ideeller Beziehung zum unvorstellbaren Raum, der endlich, aber in dem jeder einzelne Punkt Mittelpunkt ist.
Wichtig ist mir die Verstörung des farbigen Systems durch eine nur einmal im Bild erscheinende Farbe. Die Größe der Formate ergibt sich aus der Sichtbarmachung des ganzen Systems, aus nichts anderem.
Was als Peinture mißverstanden wird, ist nicht als Peinture gemeint. Auch hierbei wirkt sich das System als mehr aus als ein Gedankenspiel.
Denn das Phantom der existentiellen Angst ist kein Thema für die Kunst. Es war eines, aber nicht für alle Künstler. Die Farbe enthält einen existentiellen Wert, den ich nicht zwingen will. Aber ihn zur Gestaltung bestimmen! Ich will und will nicht bannen und nicht schocken. Vielleicht will ich dazu verführen, das Universum, unser Sein, nicht als Gegenüber zu erfahren, auch nicht das Bild als Gegenüber, sondern das Bild als universale Übereinkunft hinstellen – jenseits von mir und dem Betrachter. Ich hoffe, ich will die Freiheit, die Freiheit des sich selbst bestimmenden Menschen.