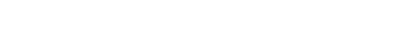Vom Gestaltwert der Farbe – Fläche, Zahl und Rhythmus
Prestel-Verlag, München 1955
Einleitung
Bildnerische Intelligenz erwirkt anderes als Intelligenz schlechthin. Sie ist elementar, ebenso nah dem Geistigen, wie dem Seelischen, wie dem Vitalen. Bewußtheit und Primitivität deuten als Gemeinsames in der Anlage den Grund desjenigen an, der in bildnerischen Formen denkt, ein Künstler ist. Er bewegt sich nicht in der Welt des Meßbaren. Trotzdem befindet er sich deshalb nicht in der Welt der Empfindungen, der Gefühle, der Beschwörungen, sondern in der Welt der Gestaltung, die eine wirkliche ist.
Bild ist im wesentlichen ein Wesen der Raumgestaltung. Bei dieser Raumgestaltung handelt es sich nicht um den perspektivischen Raum, noch um eine Flächengestaltung, die die Illusion eines Raumes zuläßt. Die Frage ist zu stellen, in welchem Sinne die Raumgestaltung im Bild heute Problem ist.
Die bekannte Setzung Cézannes, »Kugel, Zylinder und Kegel« ,war eine eigentlich geometrische, die Fläche ebenflächig gestaltende Raumvorstellung. Nach langer Auswirkung jener Bildraumgestaltung schickt sich eine neue Vorstellung des Raumes an, den in unserer Zeit veränderten Empfindungen, die der Mensch vom Raum hat, gerecht zu werden und ihnen zu folgen. Es ist als ob die Menschheit sich von Zeit zu Zeit genötigt sähe, den Vorhang der Aussage, der Beschreibung äußerer oder innerer Vorgänge beiseite zu schieben und das eigentliche Thema der Gestaltung anzugehen, den Raum. Es scheint als ob jeweils von Zeit zu Zeit das Vermögen erlischt, den Dingen Namen zu geben, weil die Dinge in einem Raum nicht mehr feststellbar, in keinem Raum mehr auffindbar sind.
Langsam – mit der Anrufung des Rhythmus – gewinnt im neuen Jahrhundert der Raum wieder Gestalt, eine andersgeartete Gestalt, und das Thema ›Raum‹ gewinnt einen neuen Aspekt. Raumgestaltung als Bild ist jetzt wiederum nicht mehr eine Tat der Projektion. Sie ist eine Tat der Wirklichkeit, die Metapher im Kunstwerk zuckt in kürzesten Schlägen. Und in neuen, sehr andersgearteten Richtungen. Raum ist heute nicht mehr vorstellbar – Raum ist denkend nicht mehr als Vorstellung zu erfahren. Wir haben heute von der arithmetischen Bildform zu sprechen, deren Grundlage die Fläche, die Zahl und der Rhythmus sind, will man Bild grundsätzlich als Gestaltung des Raumproblems verstehen. Man muß neue Ausdrücke erfinden oder alten neuen Sinn geben. Dem mythischen Bezirk kann man keine neuen Geheimnisse mehr entreißen, es kann auch nicht darum gehen, Sinn und Wert von Gefühlen und Empfindungen zu bestimmen, es geht allein um das gestaltete Bild – das Gestalt-Bild. Allerdings ist der wirkliche Vorgang im Bilde mehrwertig. Setzt man nun neue Begriffe, so muß man damit rechnen, daß sie sich überschneiden und wird feststellen, daß diese Überschneidungen im Grunde wesentlich sind.
Die bildnerische Gestaltung aus der Farbe, so will ich Malerei nennen, ist zuerst und vor allem eine Frage der Ordnung der Fläche von Grund auf, nicht aber eine Angelegenheit der Anordnung. Der Ordnung eines Bildes liegt eine geistige, bildformale, gestaltende Tendenz zugrunde. Diese erwirkt die echte Fläche, die Gestaltfarbe, die arithmetische Setzung. In diesen drei Hauptpunkten ist die Gestaltung des Bildes heute beschlossen. Das Bild ist ein einmaliges unlösbares Gebilde, ein gestalteter Tatbestand universaler Art, es ist geformte Metapher der Raumgestalt des heutigen Menschen, seine Raumidee als Gestaltung. Raum, bildnerischer Raum als Fläche, solche zugleich in sphärischer Bedingtheit, die von der natürlichen Farbe gestellt und aufgehoben wird, Kugel und flach zugleich, so daß die Dimensionsfrage in der Schwebe bleibt. Der ›ganze‹ Raum! Er ist unillusionistisch, Flachraum der Fläche, zugleich geformt durch Rhythmus, Dynamik und Chromatik. Die Elemente, aus denen sich die Flächenkunst zusammensetzt, mit denen diese Gestaltung zu bewirken ist, sind Fläche, Farbe und Linie. Diese Mittel sind, jedes einzelne in seiner besonderen Eigenart, zu erhalten und keineswegs im Zueinander zu vermischen. Daß aus den Mitteln mehr werde als nur Mittel, dazu bedarf es des formenden Geistes. Daß darüber hinaus etwas, wie man so sagt, ausgesagt werden solle, das liegt im Mittel selbst – im vom formenden Geiste erleuchteten Mittel. Um das Gestaltbild, das elementare Bild der Mittel selbst, geht es heute.
Was aber geschieht im wesentlichen, wenn das Gestaltbild, das elementare Bild der Mittel selbst, auftritt? Wozu dies Fragen nach den echten Mitteln und darüber hinaus nach den Mitteln der geistigen Konzeption, die ein Bild ermöglichen? Vor allem, wo dieses Bild weder auf der Seite des Konstruktivismus, noch auf der Seite der Gefühlsbilder zu suchen ist. Sondern da, wo das Schöpferische sich dem Elementaren verbindet.
Es geschieht im Bilde die Verdichtung der Mittel, der Mittel ersten Grades, Fläche, Farbe, Linie und der Mittel zweiten Grades, Kugel, Zahl und Rhythmus. Mit dieser Verdichtung vollzieht sich die verbindliche Gestaltung der Fläche des Bildes, derart, daß die Verbindlichkeit aus der Summe ungebrochener Verbindungen entsteht, daß somit die Vereinzelung und die Brüche zwischen den einzelnen Formen, zwischen den vereinzelten Formen, deren Zusammenhanglosigkeit, überwunden ist. Es geschieht, daß über die Klarstellung und Definition von funktionellen Werten hinaus in der Verdichtung das Funktionelle seinen materiellen Wert durch die bruchlose Verbundenheit der Formen verliert. Anders gesagt: das Funktionelle überspringt die Motorik und entwickelt sein Geistiges als Fläche – das Dynamische. In dieses Geschehen wirkt der Rhythmus ein. Der Gegenwirkung von Funktion und Rhythmus entspringt Transparenz.
1. Die Fläche
Ein Bild sehen, heißt verstehen, in welcher Weise die Fläche konzipiert ist. Die Fläche als Ausdehnung, als Flachheit, ist eine der drei Grundgegebenheiten ersten Grades. Die Fläche ist mathematisch gesprochen eine Ebene. Sie ist nicht Träger von Formen, Visionen oder Imaginationen, also Auffang von gegenständlicher, psychischer oder magischer Projektion, sondern sie ist das eigentliche Element der Gestaltung. Sie trägt nicht die Gestaltung, sondern sie erweckt sie. So ist die Fläche im Augenblick des Begehens Element der Gestaltung. Die Größe, die Flächenausbreitung ist der jeweils gegebene Flächenraum. Flächenraum heißt Flachraum. Dieser Flachraum ist von der Farbe zu begehen. Die praktische Fläche, die also tatsächlich vorhandene Ebene, mit dem ersten Farbfleck als Folie (Hintergrund) auftretend, ist in die geistige Fläche, die Gestaltfläche zu verwandeln. Die Gestaltfläche ist Fläche, die durch Übereinstimmung von Farbe und Fläche entsteht. Ihre verschiedenen Dimensionen sind zu bestimmen. Die erste Dimension ist die Höhe, die zweite die Breite, die dritte Dimension die Tiefe, die kugelförmig gedeutet werden kann. Diese Tiefendimension, als ganzer Raum, samt ihrer Deutung als Kugel, ist als Fläche zu setzen und führt so zu gestalteter Flachheit.
Auf diese Weise wird die realistische Vorstellung, die noch nach der dritten Dimension als lllusionsform verlangt, überwunden. Das bildnerische Gestalten der Fläche fordert die Aufhebung der Illusion, denn die Malerei ist Flachkunst. Was auch immer gesetzt wird, die Fläche bleibt elementare Grundbedingung als Gestalt, als der in der Flachkunst zu gestaltende Hauptwert.
Die Fläche als Flachraum stellt weder den ›Lebensraum‹ noch den des ›Universum‹ dar, sondern mit dem Auffinden einer Satztechnik der Fläche wird Fläche der umfassende Wert der Gestaltung, der der Fläche ordnende Möglichkeit gibt, jenen Raum begehend sichtbar zu machen, in dem denkbar, doch nicht vorstellbar, jeder Punkt Mittelpunkt ist.
Satztechnik in ihrer Verknüpfung zur Fläche, in ihrer Verknüpfung von Farbe und Fläche in reziproken Sätzen, steht also als geordnetes und ortendes Begehen der Fläche für das Begehen des nicht vorstellbaren Raumes.
2. Chromatik
Über die Übereinstimmung von Farbe und Fläche.
Die Fläche ist durch die Farbe zur Gestalt zu erheben. Die Farbe als realer Wert, als gestaltender Wert, die nichts anderes aussagt, als Farbe zu sein, breitet sich notwendig als Fläche aus und enthält bereits Fläche, wenn Farbe als elementarer Wert begriffen werden soll. Solange man von jeder Form der Darstellung absieht, kann Farbe nur so gedacht werden. Man setzt also die Farbe als Gestaltwert und somit auch die Gestaltfarbe als Gestaltwert der Fläche. Hier, wo es sich um Gestaltung handelt, ist Farbe nicht als physikalischer Wert gemeint, wie er in den bekannten Farbenlehren ausgedeutet wird.
Das bildnerische Denken in den Grundmitteln schaltet das naturwissenschaftliche Denken, die Erklärung auf wissenschaftlicher Basis, aus. Die Verwandlung der Fläche aus der Ebene in die Gestaltfläche beginnt, indem ich die Fläche mit einer Farbe verletze und somit die Fläche zur Folie, zum Hintergrund, zum Grund verwandle. Indem Manet hier haltmachte, entstand die nackte Projektion (›Olympia‹). Wird heute hier haltgemacht, entsteht das Plakat oder die Dekoration. Plakat ist ohne jede Transparenz. Der Betrachter schlägt auf die Fläche als Ebene auf, und dieser Schock verwandelte sich in die Illusion eines Gegenstandes, der durch das Plakat angepriesen wird.
Setze ich zu dem ersten Farbtupfen, der aus der Fläche Grund gemacht hat, einen zweiten hinzu, so wird der optische Illusionswert der Farbe sichtbar. Dieser optische Wert setzt die Relationen fest, positive Farbe, also vornliegende Farbe und negative Farbe, also zurückliegende Farbe – bezogen auf den Grund. In dieser Grundform der Relation liegt das erste Mittel, die Fläche als sphärisch bewegte Raumform flächenhaft aus der Farbe, der Gestaltfarbe, zu formen, den ganzen Raum als Fläche zu erfahren. Ich bestimme zuerst das Vor- und Zurückliegen der beiden zuerst gesetzten Farben, füge dieser ersten Relation, die zugleich in der Verschränkung des Vor- und Zurückliegens der einmal gesetzten Farben Verknüpfung herstellt, weitere Farben hinzu und gewinne dabei eine chromatische Reihe. Ich habe jedem Bild eine bestimmte Reihe von Farben derart und abschließend zuzuerkennen, daß daraus ein charakteristischer chromatischer Satz für jedes Bild entsteht. Dieser Satz ist für jedes Bild jeweils einmalig einzuhalten. Dabei kann ich ihn in Grundfarben, in diametralen Farbzusammenhängen, in Farbe zu Tonwert oder in Tonwerten setzen. In diesem Sinne habe ich vorgezogen Variationen von Grundfarben, also elementare Klänge zu setzen, kontrastiert einerseits in kalt und warm, andererseits in hell und dunkel, einen leichten Satz von Tonwerten zu geben mit der Absicht, das farbige Gefüge dazu kühl zu halten. Schwarz und Weiß sind als Farben in der chromatischen Reihe wirksam.
Unter Chromatik verstehe ich, daß ungeachtet der jeweiligen Zusammenfügung als Fläche, der Farbsatz in der Abwandlung von positiv zu negativ, von hell zu dunkel, von kalt zu warm während des ganzen Bildprozesses unverändert festliegt und unverändert eingehalten wird.
Für den Farbsatz ergeben sich also im Lauf der Arbeit bestimmte Relationen, die, indem sie jeweils eingehalten werden, das Flächenthema bestimmen. Dabei entstehen zuweilen Disharmonien, Diskrepanzen, die als sinnvoll zu bezeichnen sind. So wird auch die gleiche Farbe, vorausgesetzt, daß sie zum fixierten Farbensatz gehört, bald als positiver, bald als negativer Wert mehrfach im Bilde wiederkehren, als in sich geschlossener Wert oder als eine Fläche einschließender Wert oder als offener Flächenwert. Der Wechsel vollzieht sich nicht rational, nicht errechenbar und ist daher nicht festlegbar. Mit diesem Unternehmen gewinne ich Farbsätze, mit denen der Grund seine sphärische Gestalt erhält und zur Gestaltfläche verwandelt wird. Diesen Vorgang nenne ich die chromatische Relation.
Da ich der Farbe nur den Gestaltwert zugestehe und ihr andere Wertungen, etwa symbolischer, assoziativer oder psychischer Art nicht gestatte, könnte aus der Verbindung von Farbe und Fläche eine Art Grammatik entstehen. Aber eine Grammatik, deren Syntax auf die Fläche führt. Doch kann ich jeweils nur eine Ordnung für jedes einzelne Bild aufstellen, wenn auch im Methodischen die allgemeine Grundlage meines bildnerischen Tuns liegt.
Wenn ich die Farbe als Gestaltfarbe ansehe, darf ich nicht den Versuch machen, die Ordnung des Farbensatzes auf eine Möglichkeit einer Harmonielehre zu gründen. Ist doch jene Möglichkeit der Harmonielehre, ebenso wie die Farbenlehren, dem physikalischen Wert der meßbaren Welt entnommen. Eine Harmonielehre würde ja – in vorsichtiger Analogie zur Musik sei es gesagt – einen Generalbaß, das heißt in der Sprache der Malerei eine Grundfarbe aufsuchen, auf die sämtliche gewählten Farben jeweils überhaupt zu beziehen wären, während in der chromatischen Relation der Farben zueinander und zur Fläche für mich das einzige Gesetz zu sehen ist.
Das wesentliche Ergebnis dabei ist, daß die Fläche als Grund aufgelöst ist, aber als Fläche bestehen bleibt. Es gibt dann keinen Grund mehr. Es entsteht Plastik, ohne daß plastische Illusionen entstehen.
3. Rhythmus und Bewegung
Rhythmus ist Setzung gleicher und ähnlicher Gestaltungsformen von veränderlichem Bewegungsmoment getragen. Im Rhythmus erleben wir die Realisation der Bildgestalt. Er erhebt das bildnerische Tun aus der Interpretation, der idealisierenden, subjektiven Empfindungswelt heraus. In ihm formt sich das Universale.
In den Rhythmen sowie in den Farben treten Gegensätzlichkeiten auf, die zu Spannung und Bewegung führen. Sie bestimmen den dynamischen Charakter des Bildes. In der Realisierung des Bewegungsvorganges in einem Bilde kommt der Diagonale eine hervorragende und zugleich elementare Rolle zu, steht sie doch in einem natürlichen dynamischen Gegensatz zu dem als rein statisch empfundenen Vertikalen und dessen untrennbarer Ergänzung, dem Horizontalen.
Aus der Farbe selbst ein Bewegungsmotiv zu entwickeln, sieht folgendermaßen aus:
Ich will von einem Weiß zum Gelb. Beide Farben sind wie alle Farben statisch. In Richtung auf das Gelb kühle ich das Weiß durch Blau. Ich schattiere nicht ab, sondern setze das Blau rhythmisch in das Weiß. Dem Gelb mich nähernd, vermindert das Weiß seinen Helligkeitswert, ist zugleich in Blau gekühlt und verliert an Farbigkeit, wird zu Grau. Diesem verminderten Helligkeits- und Farbwert setze ich vom Gelb her einen zwar warmen, vom Gelb her warmen, in sich aber noch kalten, dem Grau gleichen Tonwert, Krapplack-Rosa, entgegen. Wie vom Weiß zum Grau, jetzt vom Krapplack-Rosa zum hellen Wert der warmen Farbe aufsteigend gewinne ich Gelb.
4. Volumen
Da wir uns Bewegungsvorgänge nur in der Zeit vorstellen können, Vorgänge mit zeitlichem Ablauf aber ein dem Bild fremdes Element bedeuten, so muß das Bild Elemente enthalten, die einen dynamischen Vorgang in einen statischen Zustand zurückführen, das heißt also, daß die Flächenvolumen die Aufgabe haben, Rhythmen und Bewegungsvorgänge aufzuhalten, indem sie diese figurativ simultan zur Gebundenheit vereinen. So sind die Volumen, die als Flächengrößen anzusehen sind, die Takte der Rhythmen.
5. Die Veranstaltung
Die Veranstaltung ist die bildnerische Durchführung des Form-Motivs. Form-Motiv ist zugleich Flächengestaltung des Form-Motivs. Veranstaltung steht also als Form-Motiv ebenfalls in Relation zur ganzen Fläche, derart, daß sie, indem sie gesetzt wird, zugleich das Ereignis der Flachheit des sphärischen Raumes, den ganzen Raum, mitentwickelt. Die Veranstaltung ist Erfindung.
Ein Einfall führt zu einer bestimmten, ich möchte sagen Formphysiognomie, zu einer bestimmten Formgebung als einmaligem oder wiederkehrendem Form-Motiv, wie auch als Thema des Rhythmus.
Diese das Bild bestimmende Formgebung ist Veranstaltung. Man kann das formale Gesamtsystem des Bildes eine Gesamtveranstaltung nennen, die sich aus einzelnen ineinander bezogenen Veranstaltungen fügt. Veranstaltung kann auch Zwischenspiel, sogar unbeteiligt am Ganzen sein. Die Veranstaltung entwickelt sich auf der Fläche und gibt der Fläche ›Figur‹, wobei die Forderungen der Fläche den jeweiligen Komplex bestimmen.
Physiognomik und Figur beziehen sich keinesfalls auf die Möglichkeit einer Assoziation.
6. Funktion und Relation
Alles auf der Fläche befindet sich zu allem in Relation und alles ist auch Funktion, auch die Relation der Formen und Farben zueinander und zur Fläche sind funktionell verknüpft. Die Funktion ist das von der Erfindung her sich entwickelnde Wirken des Fugenmotivs im Hinblick auf die Bildgestaltung. Ein Moment hat im spezifisch Fugenhaften Funktion, und das ist das Motiv. Der Fugensatz hat also eine funktionelle Konstruktion in sich selbst, die Veranstaltungen, die den Fugensatz bilden, sind konstruktiv verbunden. Die Durchführung des Themas ergibt eben diese konstruktive Form der Fuge und erzeugt Zwischenspiele, die man Passagen nennen könnte, nicht in der bisherigen Bedeutung von Übergängen in Form von Verbindungen, sondern in Form von auf zwei sehr verschiedene Veranstaltungskomplexe wirkende Zwischen-Veranstaltungen.
Die Relation bedeutet, daß alle Form- und Farbwerte erst existent und also wirksam sind, wenn ihr Bezug zur Gesamtfläche wie zueinander sichtbar wird, diese Beziehung zueinander als gestaltendes Thema verstanden werden kann. In der Statik der gegebenen Fläche müssen das Relative und das Funktionelle sich erfüllen und diese Erfüllung vollzieht sich durch ein gegenseitiges Durchdringen der grundsätzlichen Vorgänge und Veranstaltungen im Bild. Chromatik und Rhythmus vereinen sich, positive und negative Flächen vereinen sich, Volumen durchdringt sich mit Volumen. Diese unlösbare Durchdringung ist die Erfüllung von Funktion und Relation.
7. Kontrapunkt
Dieses Wort aus der Musik muß für die bildnerische Gestaltung definiert werden. Im dynamischen, rhythmischen Bilde ist kontrapunktische Setzung unerläßlich.
Kontrapunkt ist ein Komplex von Bezogenheiten, in denen mehrformige und mehrfarbige Figurationen in einem mehrfarbigen und mehrformigen Gesamtgefüge selbständig voneinander zu führen sind.
Durch das kontrapunktische Bemühen wird die selbständige Führung der Veranstaltungen zur eindeutigen und wesentlichen Schärfe entwickelt, so daß die Spannungen sich hart gegeneinander absetzen. Die Veranstaltungen als Grundformen miteinander klingen zu lassen und zur Gestaltung des Bildes zu erheben, dazu bedarf es des Versuches, die Relationen auf eine methodische Grundordnung zu beziehen. Dies ist die in stärksten Spannungen auszutragende chromatische Kontrapunktik.
Ein Beispiel verdeutlicht diese Idee folgendermaßen:
Nehme ich zum Grundthema der Farben den Unterschied kalte zu warme Farben und wähle ich den Komplex der warmen Farben als Dominante, so kann ich drei Werte des Komplexes der warmen Farben, etwa orange, zinnober, krapplackrosa gegen zwei Werte der kalten Farbe, etwa pariserblau hell und kobaltblau hell ausspielen. Ich habe das Verhältnis 3:2. Diese Farben, unverändert in ihrer einmaligen Erfindung gesetzt, bedürfen der Sichtbarmachung der Beziehung untereinander. Von beiden Komplexen ist diejenige Farbe zu finden, die zu beiden Komplexen Beziehung entwickelt. Das Beziehungslose ist grau. Das sich Beziehende ist violett, enthaltend rot und blau, eine Erhöhung des Grau. Will ich nun zeigen, daß diese drei Farbkomplexe warm zu kalt und dazwischen violett klingen, füge ich ihnen zur Beunruhigung eine diesem Gesamtklang völlig fremde Farbe hinzu, eine Farbe, die mit dieser Kontrapunktik nichts zu tun hat, die aber, indem ich sie in kleinen Werten einfüge, den Prozeß als solchen erst ganz sichtbar macht – ein Permanentgrün. In kleinen Werten vollzieht es die notwendige Störung und betont die eigentlich wirkenden Spannungen. Damit wirkt das Permanentgrün kontrapunktisch.
8. Die Zahl
Für die abstrakte, rhythmische Kunst ist die Zahl umfassendes Sinnbild. Die Zahl bezeichnet den Formbezirk, den geistigen Bereich, in dem die Veranstaltungen der Dimensionen der Fläche, des Rhythmus, der Dynamik stattfinden. Sie betont das Nicht-Kubische, sie setzt gleichnishaft das Abstrakte gegen das Geometrische. Die Zahl gilt hier nicht als Mittel zur Errechnung von Maßen, sie steht hier als Symbol der Flächensetzung, als Symbol für Relation und nicht als Zeichen und Mittel des Meßbaren.
Zugleich tritt der immanente Wert der Zahl im Gegensatz zu ihrem numerischen Wert in ihrer manischen Bezogenheit auf den Rhythmus zutage und faßt damit das Bild des Weltraums zusammen.
9. Das graphische Element
Das graphische Element als selbständige Veranstaltung setzt sich zur Begegnung der Farbe, zur Übereinstimmung mit der Farbe, das will heißen, zur Übereinstimmung mit dem Wege, der Bewegung und dem Rhythmus der Farbe ein, zugleich aber als Gesondertes. Dies, das Übereinstimmen des graphischen Elements mit der Farbe, unterstreicht ihren Rhythmus, zugleich aber muß das graphische Element selbständig, ohne eigentliche Beziehung zur Farbe eine Veranstaltung für die Fläche sein. Es unterstützt und bestätigt die Fläche, die von der Farbe verletzt wurde.
Andererseits tritt das graphische Element auf als unabhängige Veranstaltung oder als unabhängiges selbständiges Zwischenspiel. Im übrigen vermag es auch über die farbige, schon präzisierte Fläche hinaus den einzelnen Farbelementen des Bildes, Farbformen und farbigen Veranstaltungen den genauen, jeweils auf der Fläche genauen Platz in der sphärischen Ovalraumfläche des Bildes anzugeben. Auf keinen Fall, wie auch die Farbe selbst, übernimmt es einen psychischen Moment, eine Aussage außerhalb des Bildnerischen.
10. Human
Die Malerei ist a-human. Das Humane ist nicht Anliegen des Künstlers. Es entsteht ohne ihn, außer ihm. Oder nicht. – Das bildnerische Gestalten ist a-human.
Ich meine damit, daß sich das bildnerische Gestalten jenseits des eigentlich menschlich Beabsichtigten vollzieht. Ich möchte damit sagen, daß es gleichgültig ist, ob ein Künstler über menschliche Absichten in seiner Kunst, außerhalb seiner künstlerisch-bildnerischen Erwägungen liegende Absichten, etwas aussagt oder nicht. Dies kann geschehen, ist aber für Bilder unwichtig.
Selbst wenn eine humane Idee in der Absicht des Künstlers liegt, selbst dann erweist sich das Kunstwerk als solches endlich vorerst durch die Form.
11. Das Geistige
Das Geistige ist nicht das Seelische. Das Geistige ist auf gar keinen Fall die denkerische, sogar etwa intellektuelle Konzeption. Das Geistige ist dort, wo die Gestaltung und das Universum in Übereinstimmung sind. Raum als bildnerischer Gedanke ist die geistige Projektion des Universums als Reales.
12. Kontakt
Die eigentliche, in jeweiliger Gegenwart mögliche Verbindung von Mensch zu Mensch besteht der Künstler. Seine Werke bestätigen und bestimmen Kontakt.
13. Wahrheit
Bilder fügen dem Weltganzen ein Gran Liebe hinzu.